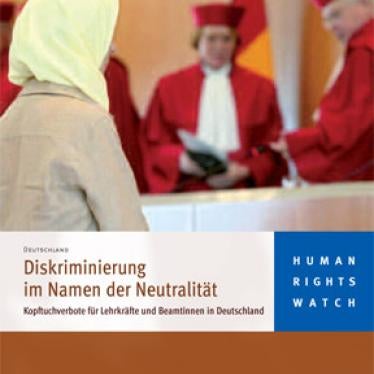(Berlin, 9. Dezember 2011) – Die deutschen Strafverfolgungsbehörden sollen besser ausgebildet werden, um rassistische, homophobe und andere Straftaten aus dem Bereich der Hasskriminalität effektiv erkennen, untersuchen und strafrechtlich verfolgen zu können, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Hintergrundpapier.
In diesem 26-seitigen Hintergrundpapier analysiert Human Rights Watch die Antwort des deutschen Justizsystems auf Hasskriminalität in sechs deutschen Bundesländern. Von einigen Fortschritten abgesehen, wie im Strafjustizsystem Fälle von Hasskriminalität in den vergangenen Jahren aufgegriffen wurden, bestehen weiterhin Lücken, und Übergriffe werden mitunter nicht entsprechend untersucht oder bei der Strafverfolgung als gewöhnliche Straftaten behandelt. Durch das jüngste Versagen deutscher Behörden bei der Untersuchung einer Neonazi-Gruppe ist der deutsche Ansatz zum Thema Hasskriminalität in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Die Neonazigruppe hatte binnen 13 Jahren in einer regelrechten Serie von Verbrechen neun Migranten und eine Polizistin ermordet.
„Diese schockierenden Morde unterstreichen, dass ein umfassender Ansatz bei der Bekämpfung von Hasskriminalität in Deutschland notwendig ist. Besonders gilt das bei Fällen, wo die Tatverdächtigen keine offensichtlichen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen haben“, erklärte Benjamin Ward, stellvertretender Direktor der Abteilung Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch. „Um derartige Straftaten identifizieren und verfolgen zu können, ist eine bessere Polizeiausbildung essentiell.“
Gautier, ein Migrant aus Kamerun, der seit acht Jahren in Berlin lebt, schilderte seine Erfahrung mit der Polizei im Jahr 2009. Er war damals von drei Männern angegriffen worden und hatte daraufhin fünf Tage im Krankenhaus gelegen: „Die erste Äußerung des Ermittlers war: ‚Warum haben Sie nicht den Rettungswagen gerufen, sondern die Polizei?’. Als nächstes fragte er nach meinen Ausweispapieren. Als drittes, ob sie einen Rettungswagen rufen sollten. … Erst später stellten sie mir eine kurze Frage danach, was passiert sei.“ Obwohl zwei der drei Männer am Tatort verhaftet worden waren, stellte die Polizei das Verfahren später ein, da sie die Täter nach ihrer Freilassung nicht lokalisieren konnte.
Im Jahr 2010 wurden nach Angaben der deutschen Bundesregierung 467 Fälle von Hasskriminalität gemeldet. Doch inoffizielle Erhebungen von Organisationen der Opferunterstützung gehen davon aus, dass die Zahlen in Wirklichkeit höher liegen. Gruppen der Opferunterstützung in den ostdeutschen Bundesländern und aus Berlin ermittelten allein für diese Bundesländer 704 derartige Übergriffe im Jahr 2010. Das Fehlen von qualifizierten Gruppen der Opferunterstützung in Westdeutschland verschleiert dort möglicherweise das reale Ausmaß der Problematik.
Das Hintergrundpapier von Human Rights Watch basiert auf Untersuchungen in insgesamt sechs westlichen und östlichen Bundesländern zwischen Dezember 2009 und September 2010. In die Erhebung sind Interviews mit Gewaltopfern, Gruppen der Opferunterstützung, Anwälten und Mitarbeitern der Landes- und Bundesbehörden, Polizeibediensteten und Staatsanwälten eingegangen. Die Untersuchung wurde in den Bundesländern Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt.
Das Hintergrundpapier benennt sowohl eine Reihe umfassender Problemstellungen bezüglich der Antwort des Strafrechtssystems auf Hasskriminalität als auch positive Beispiele. Nicht alle erkannten Probleme sind in allen Bundesländern anzutreffen, doch die Landes- und Bundesbehörden sollten diese Probleme gemeinsam in Augenschein nehmen, so Human Rights Watch.
Ein Aspekt dieser Problematik ist, dass in Deutschland Hasskriminalität als Unterkategorie von politisch motivierter Gewalt subsumiert wird. In der Praxis führt dies dazu, dass in Fällen, bei denen der vermeintliche Täter keine Verbindungen zu rechtsextremistischen Gruppen hat oder ein offensichtlich ideologisches Motiv fehlt, die Gefahr besteht, dass die Polizei Übergriffe als gewöhnliche Straftaten behandelt.
Ein weiteres Problem besteht laut der im Bericht zitierten Beispiele von Opfern und Gruppen der Opferunterstützung darin, dass die Polizei rassistischen Angriffen zwar Einhalt gebietet, es zuweilen jedoch unterlässt, die notwendigen Schritte zu einer Untersuchung einzuleiten, oder Opfer davon abbringt, Zeugenaussagen zu machen. In anderen Fällen konzentrierte sich die Polizei bei ihren Befragungen mehr auf die Opfer als auf die vermeintlichen Täter. Einige Minderheitengruppen zögern weiterhin, Angriffe der Polizei zu melden. Gruppen der Opferunterstützung in einigen Bundesländern haben den Eindruck, dass die Polizei nicht ausreichend mit ihnen zusammenarbeitet.
Ein Asylbewerber aus der Zentralafrikanischen Republik, der im Jahr 2008 außerhalb eines Nachtklubs in der Stadt Burg (Sachsen Anhalt) gemeinsam mit einem Asylsuchenden aus Saudi-Arabien von einer Gruppe angegriffen wurde, erklärte, die Polizei habe die beiden Opfer vom Tatort weggefahren, zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Befragung der vermeintlichen Täter oder von Zeugen vorgenommen. Als die beiden Opfer dies monierten, wurden sie angewiesen, still zu sein.
Die einzige wegen des Angriffs angeklagte Person wurde im März 2010 wegen Mangels an Beweisen frei gesprochen.
Staatsanwälte und Richter berücksichtigen „Hass“ nicht immer als Motivation bei der strafrechtlichen Verfolgung und Strafbemessung von Fällen, in denen es um rassistische oder andere aus Hass begangene Gewalttaten geht, obwohl sie dazu befugt sind. Gruppen der Opferunterstützung und Anwälte erklärten, dass es häufig an ihnen sei, „Hass“ als Dimension einer Straftat mit anzuführen.
Die im Hintergrundpapier enthaltenen Empfehlungen an die Behörden umfassen:
-
Eine bessere Ausbildung für alle Polizisten und Staatsanwälte hinsichtlich der Identifizierung und Untersuchung von Hasskriminalität.
-
Die Schaffung von polizeilichen Ansprechpartnern (police liaison officers) für Communities und Organisationen der Opferunterstützung. Das System der Berliner Landespolizei mit Ansprechpartnern für Personen der lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Community kann dabei als Modell dienen.
- Einen besseren Austausch mit den betroffenen Communities über die Ergebnisse von Untersuchungen und die Verfolgung von Straftaten.