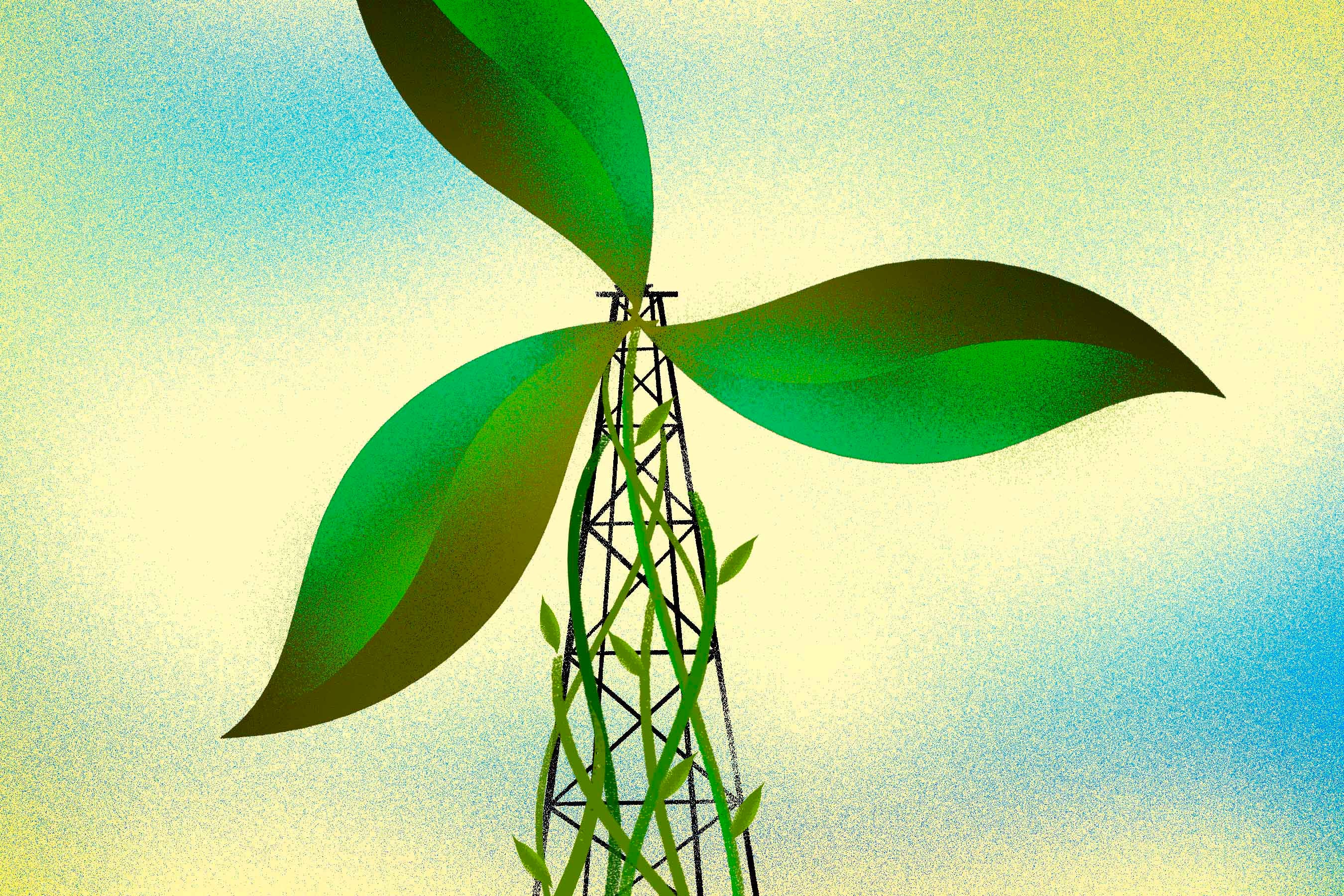Von Kriti Sharma und Shantha Rau Barriga
Schon lange bevor die Covid-19-Pandemie große Teile der Welt lahmlegte, gehörten Lockdowns, Freiheitsentzug, Gewalt und Isolation zum Alltag hunderttausender Menschen weltweit: Die Rede ist von Menschen mit Behinderungen.
Viele dieser Menschen wurden in Hütten oder Käfigen eingesperrt oder an Bäume angebunden und damit gezwungen auf geringstem Raum zu essen, zu schlafen und sich zu erleichtern, manchmal über Jahre hinweg. Und warum? Einfach nur, weil sie an einer psychosozialen Behinderung bzw. einer psychischen Krankheit litten. Die unmenschliche Praxis des „Shackling“ (engl. für „anketten“) beruht auf der weitverbreiteten Stigmatisierung psychischer Beeinträchtigungen und auf einem Mangel an adäquaten Hilfsangeboten für Betroffene und Angehörige.
Weltweit gibt es hunderttausende Männer, Frauen und Kinder – manche erst 10 Jahre alt –, die schon einmal in ihrem Leben auf diese Weise angekettet wurden. Die Praxis betrifft über 60 Länder in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika.
Covid-19 hat gezeigt, wie wichtig die psychosoziale Gesundheit und das Bedürfnis nach Bindung und Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft sind. Gleichzeitig setzt die Pandemie psychosozial beeinträchtigte Menschen erhöhten Risiken aus, denn sie leben angekettet in Privathaushalten oder in überfüllten Einrichtungen und verfügen über keinen angemessenen Zugang zu Nahrung, Trinkwasser, Hygiene, Sanitäranlagen und grundlegende medizinische Versorgung. In vielen Ländern legte Covid-19 wichtige öffentliche Leistungen lahm, was dazu führte, dass viele Menschen zum ersten Mal angekettet wurden bzw. in dasselbe Leben in Ketten zurückkehren mussten, aus dem sie bereits ausgebrochen waren.
Sodikin, ein 34-jähriger Mann mit psychosozialer Beeinträchtigung, ist einer jener zahllosen Menschen, deren Leben von der Pandemie auf den Kopf gestellt wurde. Mehr als acht Jahre lang war Sodikin in eine zwei Meter breite, strohgedeckte Hütte auf dem Grundstück seiner Familie in West-Java eingesperrt gewesen. Da staatliche Hilfsangebote fehlten, hatte seine Familie keine andere Möglichkeit gesehen, als ihn festzusetzen. In dem winzigen, von einer einsamen Glühbirne beleuchteten Lebensraum musste Sodikin schlafen, sich erleichtern und die Mahlzeiten zu sich nehmen, die seine Mutter ihm durch ein Fenster – kaum größer als seine Handfläche – hineinreichte. Der Bewegungsmangel führte mit der Zeit zu Muskelschwund.
Doch entgegen aller Wahrscheinlichkeit gelang es Sodikin, zurück ins Leben zu finden, als er schließlich Zugang zu psychologischer Behandlung und anderen Leistungen erhielt. Er begann, in einer Textilfabrik zu arbeiten, nähte Schuluniformen für Jungen und wurde sogar zum Ernährer der Familie. Seine örtliche Moschee betraute ihn mit der prestigeträchtigen Aufgabe, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Und was geschah mit der Hütte, in der er acht Jahre seines Lebens eingesperrt gewesen war? Seine Familie brannte sie nieder und legte an ihrer Stelle einen Garten an.
Als Covid-19 die Gemeinde Cianjur in der indonesischen Provinz erreichte, brach Sodikins hart erkämpfte Rückkehr ins Leben in sich zusammen. Die Gemeinde ging in den Lockdown, die Fabrik schloss, sein Alltag geriet aus den Fugen und alle gemeindebasierten Unterstützungsangebote wurden ausgesetzt.
Sodikins Familie beschloss, ihn wieder einzusperren.
Laut Michael Njenga, dem Vorsitzenden des Pan-Afrikanischen Netzwerks für Personen mit psychosozialen Behinderungen, haben „Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wie Lockdowns und Ausgangssperren zum Dahinschmelzen der verfügbaren Unterstützungsangebote geführt. Selbst in Gebieten, in denen psychische Gesundheitsangebote oder andere gemeindenahe Leistungen verfügbar sind, wurden staatliche Mittel in andere Programme verschoben, die ausdrücklich der Pandemiebekämpfung dienen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Bemühungen, Menschen zu erreichen, die jetzt möglicherweise in Institutionen eingesperrt sind oder innerhalb ihres sozialen Umfelds angekettet werden.“
Die verlängerten Lockdowns, Abstandsregeln und weitreichenden Ausfälle sozialer Leistungen im Zuge der Pandemie haben das gesellschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl beschädigt und drohen das psychische Gesundheitswesen in eine Krise zu stürzen.
Laut einer WHO-Umfrage wurden in 93 Prozent der 130 befragten Staaten psychosoziale Dienste unterbrochen. Über 40 Prozent der teilnehmenden Länder gaben an, es sei zu einer vollständigen oder teilweisen Schließung der gemeindenahen Angebote gekommen. Laut der Studie wurden drei Viertel der psychosozialen Dienste in Schulen bzw. am Arbeitsplatz unterbrochen sowie 60 Prozent aller Therapie- und Beratungsangebote insgesamt. Obwohl Regierungen weltweit die psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung als wichtige Aufgaben anerkennen, hat dies nicht zu einem Zuwachs an freiwilligen Angeboten innerhalb des gesellschaftlichen Umfelds geführt.
Regierungen sollten die Covid-19-Pandemie als Wendepunkt begreifen und sich stärker als bisher mit der Bedeutung der psychischen Gesundheit und psychosozialen Unterstützung auseinandersetzen. Denn psychische Krisen können jeden von uns treffen. Isolation, wirtschaftliche Not, zunehmende familiäre Gewalt und die täglichen Herausforderungen durch die Pandemie verursachen Unsicherheit, Angst, Unruhe und Sorgen und können so sekundäre Traumata auslösen. Man mag sich kaum vorstellen, was dies für einen Menschen bedeutet, dessen Leben ohnehin – buchstäblich – in Ketten liegt. Das Recht auf Gesundheit, insbesondere auch auf psychische Gesundheit, ist ungeachtet von Alter, Geschlecht, Ethnizität, soziokulturellem Status und kulturellem Hintergrund eines der elementarsten Menschenrechte. Es ist durch internationales Recht geschützt und stellt einen Schlüsselfaktor für das Erreichen der UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) dar.
Regierungen sollten versuchen, im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Pandemie, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, indem sie sich besonders schutzbedürftige Menschen zuwenden, einschließlich der hunderttausenden Menschen mit psychosozialen Behinderungen, die in Ketten gelebt haben oder bis heute in Ketten leben. Ihre Not im Zuge der Pandemie sollte ein Weckruf für Regierungen sein. Sie sollten die Praxis des Ankettens verbieten, die Stigmatisierung psychischer Gesundheitsleiden bekämpfen und hochwertige, barrierefreie, bezahlbare und gemeindenahe Dienste anbieten, einschließlich psychosozialer Unterstützung.
Sodikin und zahllose andere Menschen verdienen ein Leben in Würde, nicht in Ketten.