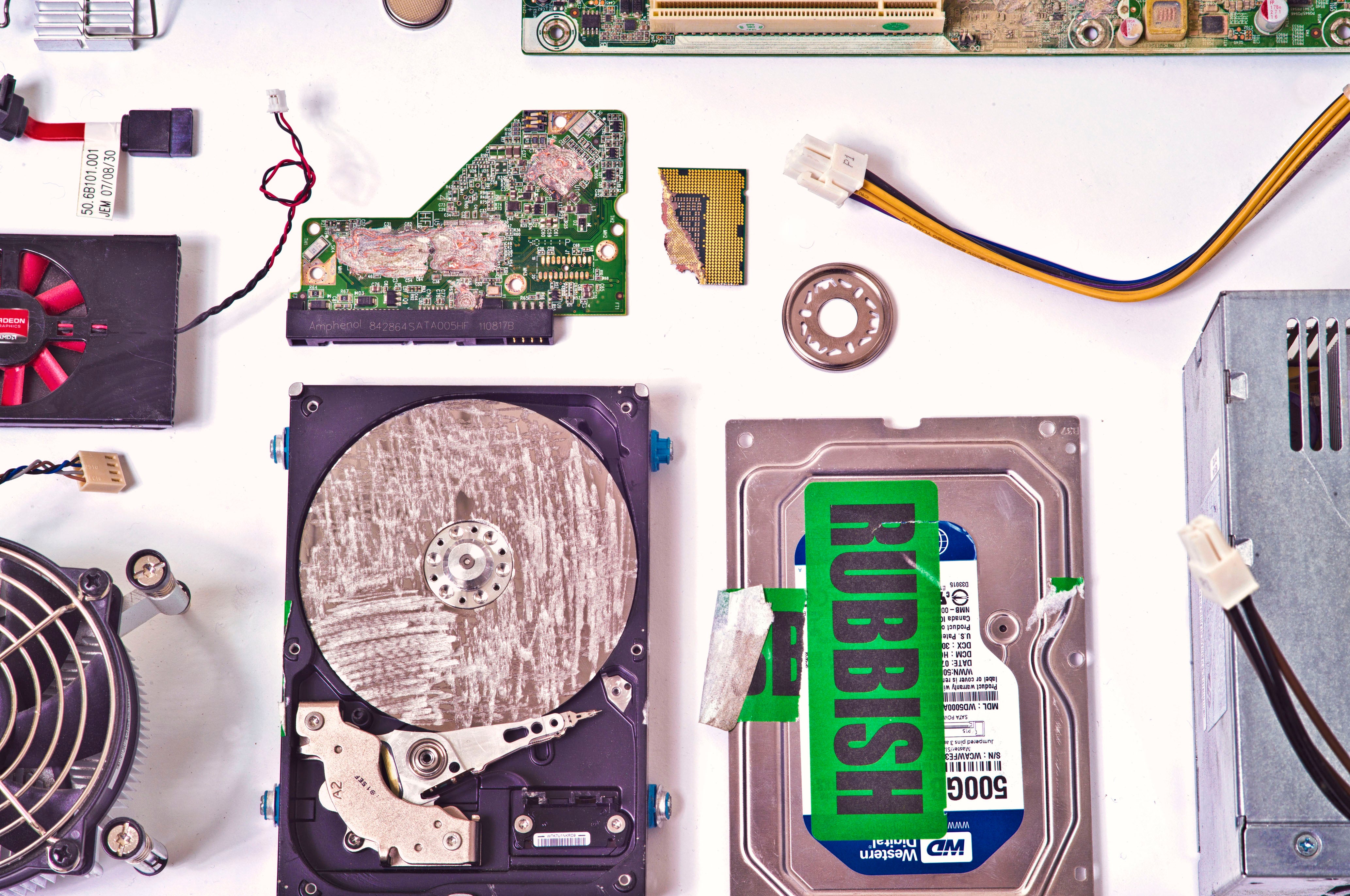von Kenneth Roth
Seit einer Generation hat die Welt keinen vergleichbaren Aufruhr mehr erlebt: An die Stelle des einst bejubelten Arabischen Frühlings sind fast überall Konflikte und Repression getreten. Islamistische Extremisten verüben im Nahen Osten und in Teilen Asiens und Afrikas Massengräuel und bedrohen Zivilisten. In der Ukraine leben Spannungen wie aus Zeiten des Kalten Krieges wieder auf, deren trauriger Höhepunkt der Abschuss eines Passagierflugzeugs war. Mitunter erscheint es, als gerate die ganze Welt aus den Fugen.
Viele Regierungen reagierten auf die Tumulte, indem sie die Bedeutung der Menschenrechte kleinredeten oder ihnen gänzlich den Rücken kehrten. Konfrontiert mit dieser politischen Unruhe, suchten viele Regierungen begierig nach Vorwänden, um das allgemeine Drängen auf demokratische Reformen zu unterdrücken. In anderen einflussreichen Hauptstädten zog man es vor, vertraute Kontakte zu Autokraten wieder aufleben zu lassen, statt sich den Ungewissheiten einer Volksherrschaft zu stellen. Während einige dieser Regierungen Menschenrechtsprobleme weiterhin ansprechen, sind offenbar viele andere zu dem Schluss gekommen, dass die Bedrohungen unserer Zeit vor den Menschenrechten Vorrang haben müssen. In dieser schwierigen Lage, so wollen sie offensichtlich argumentieren, müssen die Menschenrechte beiseite gestellt werden wie Luxusgut für bessere Zeiten.
Diese Unterordnung der Menschenrechte ist nicht nur falsch, sondern auch kurzsichtig und kontraproduktiv. Denn es waren Menschenrechtsverletzungen, die maßgeblich zur Entstehung bzw. Zuspitzung der meisten aktuellen Konflikte beigetragen haben. Ein Schlüsselelement für ihre Beilegung muss deshalb sein, die Menschenrechte zu schützen und den Menschen Mitbestimmung zu ermöglichen, wenn ihrer Regierungen auf die Krisen reagieren. Gerade in Zeiten der Prüfungen und schwierigen Entscheidungen sind die Menschenrechte ein wichtiger Kompass für jedes politische Handeln.
Der Aufstieg von ISIS
Keine Herausforderung hat sich im vergangen Jahr dramatischer entwickelt als der Aufstieg des selbst-proklamierten Islamischen Staats, der auch als ISIS bekannten Extremistengruppe. Angesichts der durch ISIS verübten Massenhinrichtungen an gefangengenommenen Kämpfern und in Ungnade gefallenen Zivilisten kann man nur entsetzt sein. Die sunnitische Miliz hat es auf Jesiden, Turkmenen, Kurden und Schiiten abgesehen, sowie auf Sunniten, die ihre extreme Interpretation des islamischen Rechts ablehnen. Die Kämpfer von ISIS haben jesidische Frauen und Mädchen versklavt, zwangsverheiratet und vergewaltigt. Sie haben Journalisten und humanitäre Helfer in abscheulichen, für die Kamera inszenierten Spektakeln enthauptet. Selten hat eine bewaffnete Gruppe auf derart breiter Front für Abscheu und Ablehnung gesorgt.
Doch ISIS ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Die Gruppe ist auch ein Produkt der von den USA angeführten Intervention und militärischen Besatzung im Irak, die im Jahr 2003 begann und die die Entstehung eines Sicherheitsvakuums und die Misshandlung von Häftlingen in Abu Ghraib und in anderen US-Haftzentren zur Folge hatte. Dabei spielte auch die Finanzierung extremistischer Gruppen durch die Golfstaaten und deren Bürger eine Rolle. Auch die sektiererische Politik der irakischen und der syrischen Regierung sowie die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber den schweren Menschenrechtsverletzungen beider Staaten waren zuletzt wichtige Faktoren. Lässt man die Missstände, die zur Entstehungen von ISIS geführt haben, weiter gären, wird die Gruppe ihren Einfluss in beiden Ländern voraussichtlich festigen und in den Libanon, nach Jordanien und nach Libyen expandieren können.
Irak
Im Irak verdankt ISIS seinen Aufstieg in großen Teilen der repressiven und spalterischen Politik des ehemaligen Premierministers Nuri al-Maliki und der daraus resultierenden Radikalisierung der Sunniten. Mit der Unterstützung des Irans übernahm Maliki persönlich die Kontrolle über die Sicherheitskräfte und unterstützte die Bildung schiitischer Milizen, von denen viele brutal gegen die sunnitische Minderheit vorgingen. Sunniten wurden von bestimmten Posten in der Regierung ausgeschlossen und viele von ihnen aufgrund neuer exzessiver Gesetze verfolgt und verhaftet, standrechtlich hingerichtet oder wahllos bombardiert.
Die Heftigkeit der Verfolgung lässt sich an der Schwere ihrer Folgen erkennen. Al-Qaida im Irak (AQI), der Vorgänger von ISIS, konnte vor allem dank der Unterstützung einer als „Erweckungsräte“ bekannten Koalition sunnitischer Stämme im Westirak besiegt werden. Doch viele der Stämme, die AQI nahezu im Alleingang bezwangen, waren derart beunruhigt über die Morde und die Verfolgung durch regierungstreue Sicherheitskräfte, dass sie es beim erneuten Ausbruch der Kämpfe im vergangenen Jahr für sicherer erachteten, gegen die Regierung zu kämpfen als gegen ISIS.
Menschenrechtsorganisationen wiesen immer wieder auf die Verbrechen unter Malikis Führung hin, doch die USA, Großbritannien und andere Staaten bevorzugten es, im Interesse einer Beendigung ihres militärischen Engagements im Irak die Augen vor Malikis spalterischer Politik zu verschließen und Maliki vielmehr mit Waffenlieferungen zu überhäufen.
Heute greift die Erkenntnis um sich, dass die Gleichgültigkeit gegenüber den Gräueltaten unter Maliki ein Fehler war. Als Maliki schließlich aus dem Amt gedrängt wurde, versprach sein Nachfolger Haider al-Abadi eine Regierung, die alle Gruppen des Landes besser intergrieren wolle. Doch während weiter westliche Militärhilfe in den Irak strömt, dauert die sektiererische Gewalt an. Maliki dient immer noch als einer der drei Vizepräsidenten, und die schwache Regierung ist immer stärker auf schiitische Milizen angewiesen. Sie ließ zu, dass knapp eine Million schiitische Kämpfer ohne staatliche Kontrolle oder Regulierung rekrutiert werden konnten. Aufgrund des Durcheinanders in der irakischen Armee stellen die Milizen die führende Bodenstreitmacht im Kampf gegen ISIS, obwohl sie weiter mit Morden und Säuberungsaktionen gegen Sunniten vorgehen, die vermeintlich mit ISIS sympathisieren. Solange diese Gräuel andauern, spielen die schiitischen Milizen den Rekrutierern von ISIS wohl eher in die Hände, als dass sie die Gruppe militärisch schwächen.
Derweil hat die irakische Regierung weder ihre wahllosen Angriffe auf Wohngebiete beendet noch in nennenswerter Zahl Häftlinge entlassen, die ohne Haftbefehl bzw. nach Ableistung ihrer Strafe festgehalten werden. Eine Reform der korrupten und mitunter kriminellen Justiz lässt weiter auf sich warten. Auch Abadis Forderung, der repressiven und wichtige Gruppen ausschließenden Politik ein Ende zu bereiten, wurde nicht umgesetzt. Langfristig ist die Vollendung dieser Reformen mindestens ebenso wichtig wie die Militäraktionen, die Zivilisten vor ISIS schützen sollen.
Syrien
In Syrien verdankt ISIS seinen Aufstieg einer Vielzahl von Faktoren, etwa der Durchlässigkeit der türkisch-syrischen Grenze, die den Zustrom von Kämpfern ermöglicht hat, welche von ausländischen Regierungen bewaffnet und finanziert werden. Viele dieser Kämpfer haben sich extremistischen Gruppen angeschlossen. ISIS finanziert sich auch durch exorbitante Lösegeldforderungen und „Steuern“ in den kontrollierten Gebieten sowie durch den Verkauf von syrischem Erdöl und Kunstschätzen.
Auf dieser Grundlage gelang es der Gruppe, sich als die Kraft zu präsentieren, die am ehesten in der Lage ist, der ungeheuren Brutalität von Präsident Baschir al-Assad und seinen Truppen die Stirn zu bieten. Assads Militär hat in hinterhältiger Weise gezielt Zivilisten angegriffen, die das Pech hatten, in oppositionellen Gebieten zu wohnen. Ziel dieses Vorgehens ist die Entvölkerung der betroffenen Landstriche und die Bestrafung mutmaßlicher Sympathisanten der Rebellen.
Seit die syrische Regierung ihre chemischen Waffen abgegeben hat, ist ihr am meisten gefürchtetes Instrument die Fassbombe, ein mit Sprengstoff und Metallfragmenten gefülltes Ölfass oder ähnliches Behältnis. Die Bombe, die auch von der irakischen Luftwaffe eingesetzt wird, hat sich in Syrien einen grausamen Namen gemacht. Die syrische Luftwaffe wirft sie typischerweise aus Helikoptern ab, die in großer Höhe fliegen, um Luftabwehrfeuer zu vermeiden. Aus solchen Höhen kann eine Fassbombe unmöglich präzise eingesetzt werden. Eine Fassbombe fällt ungelenkt und mit einem charakteristischen Rascheln, welches durch das Hin- und Herkippen ihres Inhalts entsteht, in Richtung Erdboden und detoniert beim Aufschlag.
Fassbomben sind derart unpräzise, dass das syrische Militär sie nicht in der Nähe der Front einsetzt, weil sie fürchtet, eigene Truppen zu treffen. Stattdessen lassen die Militärs sie weit über dem Gebiet der Rebellen abwerfen und nehmen dabei in Kauf, dass Wohnblocks, Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Einrichtungen zerstört werden. Die wahllos tötende Waffe terrorisiert viele Zivilisten derart, dass manche der verbliebenen Bewohner beschließen, in die Nähe der Front ziehen, da sie die Gefahr durch Scharfschützen und Artillerie dem Horror der Fassbomben vorziehen.
Als die syrische Regierung Zivilisten mit chemischen Waffen angriff, drängte der UN-Sicherheitsrat Assad, die Angriffe einzustellen und seine Chemiewaffen abzugeben. Doch als die syrische Regierung eine viel größere Zahl Zivilisten durch wahllose Angriffe mit konventionellen Waffen wie Fassbomben, Streubomben, Brandwaffen und ungelenkten Raketen tötete, sah der Sicherheitsrat weitgehend tatenlos zu. Einige Staaten haben das Morden zwar verurteilt, doch sie tun wenig, um echten Druck gegen das wahllose Töten aufzubauen.
Russland nutzte sein Veto im Sicherheitsrat, um geeinte Bemühungen für ein Ende des Gemetzels zu blockieren. Russland und der Iran weigern sich auch, ihren enormen Einfluss in Damaskus geltend zu machen, um auf ein Ende der wahllosen Angriffe zu drängen, obwohl der Sicherheitsrat, dem auch Russland angehört, einen Stopp derartiger Attacken forderte. Ein Tabuthema scheint für Moskau auch die Einschaltung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zur Untersuchung schwerer Völkerrechtsverletzungen durch alle Parteien zu sein, ein Schritt den mehr als 65 Staaten unterstützen.
Während eine von den USA geführte Koalition weiter gegen ISIS kämpft, hat kein einziges Land – seien es Gegner wie die USA oder Unterstützer wie Russland und der Iran – den Druck auf Assad erhöht, um dessen Gewalt gegen Zivilisten zu stoppen. Beide Aspekte können und dürfen jedoch nicht getrennt betrachtet werden.
Das selektive Interesse an ISIS war ein Geschenk an dessen Rekrutierer, die sich als die einzige Kraft darstellen konnten, die bereit und in der Lage ist, sich gegen Assads Gräuel zu behaupten. Bloße Militäraktionen gegen ISIS werden die Anziehungskraft der Gruppe nicht zerstören. Das Hauptanliegen sollte vielmehr der Schutz der syrischen Zivilbevölkerung sein.
Verstärkte Repression in Ägypten
In Ägypten versucht das Regime des zum Präsidenten ernannten Generals Abdel Fattah al-Sisi, die demokratischen Bestrebungen der Tahrir-Platz-Bewegung zunichte zu machen. Der Aufstand, der die autoritäre Regierung von Präsident Hosni Mubarak gestürzt hatte, bescherte Ägypten die ersten freien und fairen Präsidentschaftswahlen, aus denen Mohammed Mursi, der Kandidat der Muslimbruderschaft, als Sieger hervorging. Mursis Regierunsstil ließ in der ägyptischen Bevölkerung jedoch Befürchtungen aufkommen, ihr Land werde sich allmählich zu einem streng islamischen Regime entwickeln. Dennoch waren die Menschenrechtsverletzungen der Mursi-Regierung zu keinem Zeitpunkt mit jenen vergleichbar, die dem ägyptischen Volk heute durch ihre vom Militär dominierte Regierung zugefügt werden, welche Mursi am 30. Juni 2013 gestürzt hatte.
Der von Sisi angeführte Militärputsch hatte eine niederschmetternde Wirkung auf die Muslimbruderschaft und deren Anhänger. Am 14. August 2013 erschossen die Sicherheitskräfte unter dem Kommando von Sisi und Innenminister Mohammed Ibrahim in nur 12 Stunden mindestens 817 größtenteils friedliche Demonstranten auf dem Platz vor der Raba-al-Adawija-Moschee in Kairo, wo diese seit einer Woche mit einem Sitzstreik gegen Mursis Entmachtung demonstriert hatten. Die Sicherheitskräfte behaupteten, sie hätten sich verteidigt, doch die geringen Verluste in ihren Reihen verblassen im Vergleich mit der Zahl an Demonstranten, die von Scharfschützen und anderen Bewaffneten erschossen wurden, viele während sie sich medizinisch behandeln ließen. Die ägyptischen Behörden hatten die gewaltsame Auflösung des Sitzstreiks wochenlang geplant und mit einer hohen Zahl von Todesopfern gerechnet. Die Folge war das größte Massaker an Demonstranten in der jüngeren Geschichte, mindestens das blutigste seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz in China im Jahr 1989.
Seit dem Staatsstreich haben Sisis Sicherheitskräfte Zehntausende mutmaßliche Mitglieder der Muslimbruderschaft sowie zahlreiche andere Aktivisten inhaftiert, häufig ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Die ägyptische Justiz hat nach Massenprozessen, die noch nicht einmal den Schein einer individuellen Beweisführung oder der Möglichkeit zu einer Verteidigung wahrten, Hunderte Todesurteile verhängt.
Die Antwort der internationalen Gemeinschaft auf diese beispiellose Unterdrückung war beschämend. Im UN-Sicherheitsrat forderten 27 Staaten Ägypten zu einer Untersuchung des Massakers auf, es gelang ihnen jedoch nicht, eine Mehrheit innerhalb des Rats zu gewinnen.
Die Bereitschaft der USA, Großbritanniens und anderer wichtiger europäischer Regierungen, den Verbrechen der Militärregierung nachzugehen, scheint gering. So verhängte Washington einerseits gezielte Sanktionen gegen venezolanische Regierungsvertreter wegen der brutalen Reaktion ihrer Sicherheitskräfte auf die Massenproteste in Venezuela, bei denen „nur“ einige Dutzend Demonstranten starben (wenngleich unzählige weitere schikaniert wurden), lehnte aber andererseits Sanktionen gegen Ägypten ab, dessen Regierung auf dem Platz vor der Raba-al-Adawija-Moschee fast 1.000 Demonstranten ermorden ließ.
Der Kongress kürzte die US-Militärhilfe an Ägypten, doch die Obama-Regierung vermied es aus Furcht vor rechtlichen Konsequenzen, den Machtwechsel als „Putsch“ zu bezeichnen. Außenminister John Kerry sagte wiederholt, Ägypten befinde sich im Übergang zur Demokratie, obwohl dafür jeder Anhaltspunkt fehlte. Nun, da der Kongress die Bedingungen für US-Militärhilfe um eine Ausnahme aus Gründen der nationalen Sicherheit erweitert hat, nimmt die US-Regierung offenbar ihre Militärhilfe an Ägypten teilweise oder sogar vollständig wieder auf, ohne dass die Führung in Kairo ihre Repression eindämmt. Hinter der Eile, mit welcher nun der Geldhahn wieder aufgedreht wird, steht eine Prioritätensetzung: Der Schutz der Rechte der Ägypter wird hinter das Interesse gestellt, das ägyptische Militär für die Eindämmung des Aufstands auf der Sinai-Halbinsel, die Unterstützung Israels im Kampf gegen Hamas in Gaza und den Krieg gegen ISIS in Syrien und im Irak zu gewinnen. Großbritannien, Frankreich und andere europäische Regierungen haben ebenfalls wenig unternommen, um Sisis beispielloser Unterdrückung entgegenzutreten.
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben Ägypten bei der Niederschlagung der Muslimbruderschaft bereitwillig unterstützt. Als Monarchien, die sich zur eigenen Legitimierung auf den Islam berufen, haben sie offensichtlich große Angst vor einer religiösen Bewegung, die im Namen des Islam regiert und dennoch demokratische Wahlen befürwortet. Beide Staaten haben Sisis Unterdrückung mit Milliarden von Dollars unterstützt und die Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft. Die VAE gingen auch im eigenen Land gegen Personen vor, die mutmaßlich die Ansichten der Muslimbruderschaft vertreten.
Die internationale Unterstützung für die repressive Sisi-Regierung ist nicht nur vernichtend für die Hoffnungen der Ägypter auf eine demokratische Zukunft. Sie sendet auch eine furchtbare Botschaft an die gesamte Region. ISIS kann jetzt glaubwürdig argumentieren, Gewalt sei für Islamisten der einzige Weg an die Macht – schließlich habe man sie unter geringem internationalen Protest gestürzt, als sie durch faire Wahlen an die Macht gelangt waren. Auch hier droht, dass das kurzfristige Interesse einiger einflussreicher Mächte an der Schwächung der Muslimbruderschaft zu einem Debakel für die langfristige politische Zukunft der Region wird.
Israelisch-Palästinensischer Konflikt
Im vergangenen Jahr beobachteten wir einen verstärkten Siedlungsbau durch Israel, mehr wechselseitige Gewalt im Westjordanland und eine neue Runde blutiger bewaffneter Konflikte in Gaza. Die Hamas und andere bewaffnete Palästinenserorganisationen schossen wahllos Tausende Raketen und Mörsergranaten in Richtung der israelischen Ballungsräume. In einigen Fällen brachten die Hamas und ihre Alliierten palästinensische Zivilisten unnötig in Gefahr, indem sie aus Wohngebieten heraus operierten. Ferner ließen sie mutmaßliche Verräter standrechtlich hinrichten.
Zehntausende israelische Raketen, Bomben und Artillerieangriffe, eine weitreichende Definition legitimer militärischer Ziele, Angriffe ohne erkennbares militärisches Ziel und eine geringe Sorge um ziviler Opfer führten zum Tod von schätzungsweise 1.500 Zivilisten in Gaza und zu einer beispiellosen Zerstörung von Wohngebäuden und ziviler Infrastruktur. Im besetzten Westjordanland dehnte Israel nicht nur seine Siedlungen aus, sondern setze auch diskriminierende und als Strafmaßnahmen vorgenommene Abrisse palästinensischer Häuser fort. Auch der unnötigen Einsatz von tödlicher Gewalt gegen Palästinenser dauerte an und kostete Dutzende Menschen, darunter auch Kinder, das Leben.
Israels Bilanz bei der Verfolgung schwerer Kriegsrechtsverletzungen durch eigene Truppen ist dürftig, während die Hamas noch nicht einmal behauptet, sie gehe Verstößen durch palästinensische Kämpfer nach. Eine Einschaltung des IStGH könnte dazu beitragen, beide Seiten vor weiteren Kriegsverbrechen abzuschrecken und den Opfern ein Minimum an Gerechtigkeit zu verschaffen. Mit seinem Beobachterstatus bei der UN ist Palästina berechtigt, dem IStGH beizutreten. Palästinensische Spitzenpolitiker zeigten sich daran zwar interessiert, ließen jedoch keine Taten folgen. Sollte Palästina dem IStGH beitreten, hätte dieser die Rechtsprechung über Kriegsverbrechen, die auf palästinensischem Gebiet bzw. von dort aus verübt werden. Dabei würde sein Mandat für beide Parteien des Konflikts gelten.
Die USA und führende EU-Regierungen setzen Palästina jedoch unter Druck, dem in Den Haag ansässigen Gericht nicht beizutreten. Sie argumentierten, dass eine Einmischung des IStGH kontraproduktiv für den ohnehin weitgehend erstarrten Friedensprozess sei. In praktisch jeder anderen Situation, in der in großem Maßstab Kriegsverbrechen verübt werden, vertreten diese Staaten jedoch den entgegengesetzten Standpunkt. Sie erkennen dann an, dass eine Eindämmung der Verbrechen meist die Voraussetzung für eine Vertrauensbasis ist, welche produktive Friedensgespräche erst möglich macht. Niemand konnte bislang überzeugend erklären, warum der israelisch-palästinensische Konflikt eine Ausnahme von dieser Regel darstellen sollte.
Das wahre Motiv der westlichen Regierungen ist es, Israelis vor einer möglichen Strafverfolgung zu schützen. Diese selektive Sicht auf die internationale Justiz untergräbt deren Stärke und Legitimation in der ganzen Welt und bestärkt ihre Kritiker, in deren Augen die internationale Justiz nur für schwache Nationen gilt, die keine Verbündeten der großen Mächte sind.
Die Gräuel von Boko Haram in Nigeria
Dass Unruhen zu einer Abkehr von den Menschenrechten führen, beschränkt sich nicht auf den Nahen Osten. Die Menschenrechte sind auch im Konflikt in Nigeria zentral, wo die militant-islamistische Gruppierung Boko Haram nigerianische Sicherheitskräfte und Zivilisten gleichermaßen ins Visier nimmt. Die bewaffnete Gruppe ist berüchtigt geworden für ihre Bombenattentate auf Märkte, Moscheen und Schulen, bei denen Tausende Zivilisten getötet wurden. Im vergangenen Jahr entführte Boko Haram im Nordosten Nigerias Hunderte Schülerinnen und junge Frauen. Einige wurden gezwungen, Kämpfer zu heiraten, und sexueller Gewalt unterworfen. Eine Massenentführung im April löste die weltweite Social Media-Kampagne #BringBackOurGirls aus. Dennoch befinden sich diese Opfer und viele andere weiter in Gefangenschaft.
Man sollte meinen, das ölreiche Nigeria sei in der Lage, eine professionelle, die Menschenrechte achtende Armee ins Feld zu schicken, um die Nigerianer vor dieser Verbrechergruppe zu schützen. Doch die Regierung hat zugelassen, dass ihr Militär schlecht ausgerüstet und mit geringer Motivation gegen Boko Haram zu Felde zieht.
Wenn die Armee einschreitet, handelt sie oft rechtswidrig. Sie treibt Hunderte Jungen und Männer zusammen, die verdächtigt werden, Boko Haram zu unterstützen, inhaftiert sie unter unmenschlichen Bedingungen und misshandelt oder tötet sie. Viele Gemeindevertreter wurden verschleppt, angeblich von Sicherheitskräften. Als im März mutmaßliche Boko Haram-Mitglieder aus dem für unmenschliche Haftbedingungen berüchtigten Haftzentrum Giwa Barracks ausbrachen, fingen die nigerianischen Sicherheitskräfte Berichten zufolge Hunderte Geflohene wieder ein und exekutierten sie.
Die weiter fehlende Verfolgung dieser Gräueltaten erschwert es Nigerias Partnern, sicherheitspolitische Unterstützung zu leisten, da sie fürchten müssen, selbst zu Komplizen bei Menschenrechtsverletzungen zu werden. Durch ihr Versagen bei der Disziplinierung ihrer Sicherheitskräfte hat die nigerianische Regierung auch viele Gemeinden in den betroffenen Regionen gegen sich aufgebracht, die den Behörden andernfalls bereitwillig Informationen geliefert hätten. Um die „Herzen und Köpfe“ der Zivilbevölkerung zu gewinnen, muss die Regierung mutmaßliche Verbrechen durch die Armee transparent untersuchen und die Täter bestrafen.
Kenias rechtswidriges Vorgehen gegen Al-Schabaab
Wie Nigeria nahmen auch in Kenia extremistische Übergriffe gegen Zivilisten stark zu, zumindest teilweise auch durch rechtswidrige Reaktionen der Sicherheitskräfte geschürt. Die somalische Rebellengruppe Al-Schabaab verübte ihre spektakulärsten Angriffe in einem Einkaufszentrum in Nairobi, in Mpeketoni und benachbarten Dörfern entlang der Küste und in Mandera im Nordosten Kenias.
Kenias Antwort auf die Gewalt war durchsetzt von Menschenrechtsverletzungen. Statt das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken, solche Attacken wirksam bekämpfung zu können, haben die Operationen der Sicherheitskräfte für Wut und Misstrauen gesorgt. Nach Bomben- und Granatangriffen in Nairobi im April führten Militär und Polizei im Vorort Eastleigh die Operation „Usalama Watch“ durch, eine Großrazzia, die zu Menschenrechtsverletzungen gegen gemeldete Asylbewerber und Flüchtlinge, nicht gemeldete Somalier und andere Ausländer sowie gegen Kenianer somalischer Herkunft führte. Wie bei ähnlichen vorausgegangen Operationen ging die Polizei mit übermäßiger Härte vor und nahm willkürlich Tausende Menschen fest. Sie durchsuchte Wohnungen, erpresste Anwohner und misshandelte Menschen somalischer Abstammung.
Unterdessen verdichteten sich die Hinweise, dass kenianische Antiterroreinheiten Terrorverdächtige verschleppen und standrechtlich hinrichten, statt sie vor Gericht zu bringen. Doch anstatt auf den öffentlichen Aufschrei zu reagieren, versuchte die Regierung, die Überbringer der schlechten Nachrichten zu knebeln, indem sie den Sicherheitskräften weitere Vollmachten erteilte und die gesetzliche Überwachung der Medien, der Zivilgesellschaft und anderer Quellen unabhängiger Kritik ausbaute. Geberländer wie die USA und Großbritannien, die den Antiterrorkampf der kenianischen Sicherheitskräfte massiv unterstützen, reagierten verhalten auf die immer größere Fülle von Beweisen für dieses rechtswidrige Vorgehen.
Russland und die Ukraine-Krise
Russlands Besetzung der Krim und seine Militärhilfe an die Rebellen in der Ostukraine stellten westliche Regierungen vor erhebliche diplomatische und sicherheitspolitische Herausforderungen. Im Kern des Konflikts stehen Fragen der Souveränität, zu denen Human Rights Watch keine Position bezieht. Doch die relativ zurückhaltende Reaktion des Westens auf die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen in Russland in den beiden vorausgegangenen Jahren könnte die Krise in der Ukraine durchaus verschärft haben.
Westliche Regierungen übten intensiven politischen Druck auf Russland aus, etwa durch gezielte Sanktionen, um es zum Rückzug aus der Krim und zur Beendigung seiner Unterstützung für die Rebellen zu drängen. Doch sie unterschätzten dabei zumeist entweder den immer autoritäreren Kurs, den Russland seit Putins Wiederwahl verfolgt, oder sie hatten Schwierigkeiten, damit umzugehen.
Aus Furcht vor einer möglichen „Farbrevolution“ schlug der Kreml 2012 einen politischen Kurs ein, der zu einem seit Sowjetzeiten beispiellosen Durchgreifen gegen Andersdenkende geführt hat. Durch gezielte Maßnahmen gegen Menschenrechtsorganisationen, Regierungskritiker, unabhängige Journalisten, friedliche Demonstranten und Kritiker im Internet schränkte die russische Regierung die Möglichkeit dramatisch ein, eine große Zahl Menschen mit kritischen Ansichten zu erreichen. Das daraus hervorgegangene geschlossene Informationssystem erlaubte es dem Kreml, öffentliche Kritik an seinem Vorgehen in der Ukraine größtenteils zu unterdrücken. Die Unversehrtheit der Bürgerrechte in Russland sollte ein zentraler Aspekt jeglicher Bemühungen sein, den Konflikt in der Ukraine beizulegen, was bislang leider nicht der Fall war.
Gefangen in einer Art neuem Kalten Krieg mit Russland neigte der Westen dazu, in ein Gut-Böse-Denkschema zurückzufallen. Der Wunsch, die Ukraine als unschuldiges Opfer der russischen Aggression zu präsentieren, ließ den Westen zögern, die problematischen Gesichtspunkte im Vorgehen der Ukraine zu kritisieren: sei es der Einsatz von „Freiwilligenbataillonen“, die regelmäßig Gefangene misshandelten, oder der wahllose Beschuss bewohnter Gebiete. Gleichzeitig misshandelten auch die prorussischen Kräfte in der Ostukraine Häftlinge schwer und gefährdeten die Zivilbevölkerung, indem sie Raketen aus Wohngebieten heraus abfeuerten. Die Zögerlichkeit des Westens, wenn es um die Kritik an Menschenrechtsverletzungen der Ukraine ging, politisierte die westliche Position, deren Kern es eigentlich sein sollte, beide Seiten prinzipientreu zur Achtung des Völkerrechts aufzufordern. Eine solche Zielsetzung könnte die Gemüter beruhigen und die Wahrscheinlichkeit einer umfassenden politischen Lösung erhöhen.
Chinas Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang
Die Politik der chinesischen Regierung in der nordwestlichen Provinz Xinjiang, die Region der muslimischen Minderheit der Uiguren, besteht darin, auf Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen mit weiteren Menschenrechtsverletzungen und Restriktionen zu reagieren. Die Regierung in Peking behauptet, das harte Vorgehen sei zur Bekämpfung von Separatismus und Terrorismus notwendig. Diese Taktik beinhaltet jedoch vor allem äußerst drakonische und diskriminierende Maßnahmen gegen die Uiguren, etwa das Verbot von Kopftüchern bzw. Bärten, Einschränkungen des Fastens und eine offenkundige Diskriminierung im Bereich der religiösen Erziehung.
Die eskalierenden tödlichen Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte in Xinjiang stellten ein erhebliches Problem für die Regierung dar. Doch die Eile, mit der sie die Gewalt „uigurischen Terroristen“ zuschreibt – während nur selten Beweise vorgelegt werden und den Tatverdächtigen routinemäßig das Recht auf ein faires Verfahren verweigert wird – hat in einen Teufelskreis geführt, in dem sich die ohnehin unterdrückten Uiguren ständig unter Bedrängnis durch den Staat fühlen. Aus den wenigen öffentlich zugänglichen Informationen lässt sich unmöglich mit Sicherheit beurteilen, ob die Verurteilten und meist mit dem Tode Bestraften tatsächlich für Gewaltakte verantwortlich waren und ob die harten Antiterrormaßnahmen der Regierung die richtigen Personen ins Visier nehmen.
Fälle wie die außergewöhnlich harte Bestrafung des gemäßigten uigurischen Ökonomen Ilham Tohti, der im September zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, zeigen, dass die Behörden weiterhin nicht bereit sind, zwischen friedlichen Kritikern und Gewaltbereiten zu unterscheiden. Wenn man friedliche Kritik unerbittlich bestraft, der religiösen und kulturellen Freiheit praktisch keinen Platz lässt und eine Wirtschaftspolitik vorantreibt, die es Uiguren nicht erlaubt, gleichberechtigt mit han-chinesischen Migranten zu konkurrieren, so ist dies ein Patentrezept für weitere Gewalt.
Mexikos Menschenrechtsverletzungen im Drogenkrieg
Im Jahr 2007 begann die Regierung des damaligen Präsidenten Felipe Calderón ihren „Krieg gegen die Drogen“ in Mexiko, in dessen Rahmen sie massenhaft Sicherheitskräfte zur Bekämpfung der gewalttätigen Drogenkartelle abkommandierte. Das Ergebnis war eine Epidemie von willkürlichen Hinrichtungen, Verschleppungen und Folter durch Militär und Polizei, ausufernde Gewalt zwischen konkurrierenden Verbrecherorganisationen und eine Sicherheitskatastrophe, die mehr als 90.000 Mexikanern das Leben gekostet hat. In seinen ersten beiden Amtsjahren mäßigte Mexikos derzeitiger Präsident Enrique Peña Nieto zwar die Rhetorik, ergriff jedoch keine nennenswerten Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption und der Straflosigkeit, welche das Aufblühen der Gräueltaten ermöglicht haben.
Washington unterstützt Mexikos Politik im „Drogenkrieg“, kooperiert mit den mexikanischen Sicherheitskräften und lobt immer wieder deren Anstrengungen bei der Bekämpfung der Kartelle. Was ausblieb, waren jedoch offene Worte zu den furchtbaren Menschenrechtsverletzungen der Sicherheitskräfte und eine Durchsetzung der Menschenrechtskriterien, an die der US-Kongress einen Teil der Militärhilfen geknüpft hatte. Die Obama-Regierung zog es offenbar vor zu schweigen, statt einen wichtigen Verbündeten in Verlegenheit zu bringen und die bilaterale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels und anderen politischen Prioritäten zu gefährden. Dies erleichterte es der mexikanischen Regierung, ihre schweren Menschenrechtsverletzungen herunterzuspielen.
Einige US-Bundesstaaten dachten weiter: Sie legalisierten Marihuana und entzogen damit dem Schwarzmarkt für diese Droge seine Grundlage. Die Obama-Regierung duldete diese Initiativen, begrüßte sie jedoch nicht offen. Dies sollte sie jedoch tun, denn die Maßnahmen sind nicht nur im Hinblick auf das Recht auf Privatsphäre der einzig richtige Weg, sondern auch ein wichtiges Mittel, um die blühenden Geschäfte der Drogenschmuggler zu durchkreuzen.
USA: Straflose Folter durch die CIA
Zum Ende des Jahres veröffentlichte der Geheimdienstausschuss des US-Senats eine bearbeitete Fassung seines Berichts über den Einsatz von Folter gegen Terrorverdächtige durch die CIA unter der Regierung von Ex-Präsident George W. Bush.
Präsident Obama bezog während seiner gesamten Amtszeit klar Stellung gegen Folter. Schon am zweiten Tag im Amt untersagte er den von der Bush-Regierung autorisierten Einsatz „erweiterter Verhörmethoden“, ein Euphemismus für Folter, und ordnete die Schließung der geheimen Haftzentren der CIA an, in denen ein Großteil der Folter erfolgte. Nichtsdestotrotz weigerte Obama sich standhaft, die Folter der CIA unter Bush untersuchen, geschweige denn strafrechtlich verfolgen zu lassen, obwohl die von den USA im Jahr 1994 ratifizierte Antifolterkonvention dies eindeutig fordert.
Es gibt viele denkbare Gründe für Obamas Ablehnung. Ein Grund könnte die Befürchtung sein, dass solche Ermittlungen zur einer politischen Spaltung führen und die Unterstützung der Bush-Anhänger im US-Kongress für Obamas Gesetzesvorhaben gefährden könnte, wenngleich es dort bislang keine nennenswerte Zusammenarbeit gab. Obama könnte es auch für unfair gehalten haben, eine Strafverfolgung einzuleiten, nachdem das Büro für Rechtsberatung im Justizministerium die „erweiterten Verhörmethoden“ für rechtmäßig befunden hatte. Laut des Senatsberichtswar der CIA jedoch bekannt, dass die Maßnahmen Folter entsprechen. Offenbar deshalb hatte sie nach einem politisierten Beratergremium in der Regierung Ausschau gehalten, welches ihr die Rechtmäßigkeit dieser nicht zu rechtfertigenden Methoden bestätigen würde. Möglicherweise glaubte Obama auch, dass der Rückgriff auf extreme Verhörmethoden angesichts der ernsthaften Bedrohungslage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nachvollziehbar war. Laut des Senatsberichts lieferte die Folter jedoch wenig bis keine verwertbaren Erkenntnisse, während sie Amerikas Ansehen in der Welt beschädigte und die Bekämpfung des Terrorismus erschwerte.
Obamas Entscheidung, keine strafrechtliche Ermittlungen zuzulassen, bedeutet, dass das Folterverbot in den USA weiterhin nicht durchgesetzt wird. Dies versetzt künftige Präsidenten, die unausweichlich mit ernsthaften Bedrohungen konfrontiert sein werden, in die Lage, Folter als strategische Option zu behandeln. Das Ausbleiben von Ermittlungen schränkt außerdem die Fähigkeit der US-Regierung massiv ein, andere Staaten zur Strafverfolgung ihrer Folterer zu drängen, und schwächt damit eine wichtige Stimme für die Menschenrechte in einer Zeit, in der prinzipientreue Unterstützung dringend benötigt wird.
Die Enthüllungen des Senatsberichts müssen auch in Europa Konsequenzen haben, insbesondere in jenen Staaten, die CIA-Haftzentren auf ihrem Territorium zuließen oder für die Überstellung und anschließende Folter von Häftlingen mitverantwortlich waren. Italien ist bislang das einzige europäische Land, in dem Personen wegen ihrer Beteiligung an den Menschenrechtsverletzungen der CIA angeklagt wurden. Polen hat endlich eingeräumt, eine geheime Einrichtung beheimatet zu haben, die strafrechtlichen Ermittlungen dazu stehen jedoch still. Rumänien und Litauen streiten weiterhin alle Vorwürfe ab.
In Großbritannien sind zwar strafrechtliche Ermittlungen im Gange, doch die Regierung hat ihr Versprechen gebrochen, eine wirklich unabhängige justizielle Untersuchen der britischen Beteiligung an Häftlingsüberstellungen und Folter durchzuführen. Um die Verantwortlichen zu bestrafen und zu verhindern, dass diese Verbrechen sich wiederholen, ist es unerlässlich, Rechenschaft über Europas Rolle einzufordern.
Fazit: Die zentrale Rolle der Menschenrechte
In allen hier genannten Fällen können die politischen Entscheidungsträger vermeintlich stichhaltige Argumente dafür vorbringen, warum die Menschenrechte untergeordnet werden müssen. Denn die Menschenrechte zwingen zur Zurückhaltung. Gegenüber der Einstellung „Wir tun alles, was nötig ist“, welche sich im Angesicht einer ernsten Bedrohung häufig durchsetzt, mag dies als Gegensatz erscheinen. Das vergangene Jahr hat jedoch gezeigt, wie kurzsichtig dieser Reflex sein kann. Menschenrechtsverletzungen sind häufig Auslöser dieser Bedrohungen und ihr Fortdauern verschärft die Probleme zumeist.
Die Menschenrechte sind keine willkürlichen Einschränkungen der Regierungsarbeit. Sie spiegeln fundamentale Werte wider, die weithin geteilt und hochgeschätzt werden. Sie zeigen der Macht von Regierungen Grenzen auf und haben eine unverzichtbare Schutzfunktion für die Würde und Selbstbestimmung des Menschen. Diese Werte zu verraten endet selten gut. Einer Bedrohung entgegenzutreten, verlangt nicht nur, gefährliche Personen in Schach zu halten, sondern auch das moralische Gefüge wiederherzustellen, welches die soziale und politische Ordnung trägt.
Die kurzfristigen Vorteile, wenn diese zentralen Werte und die in ihnen widergespiegelte Weitsicht geschwächt werden, rechtfertigen selten den Preis, den dieses Vorgehen auf lange Sicht unausweichlich fordert. Statt die Menschenrechte als lästige Einschränkung von Handlungsfreiheit zu betrachten, täten die politischen Entscheidungsträger gut daran, sie nicht nur als moralischen Wegweiser, sondern auch als rechtliche Verpflichtung anzuerkennen. Wer dies beherzigt, tut mit größter Wahrscheinlichkeit nicht nur das einzig Richtige, sondern handelt auch am wirksamsten.
Kenneth Roth ist Executive Director von Human Rights Watch.