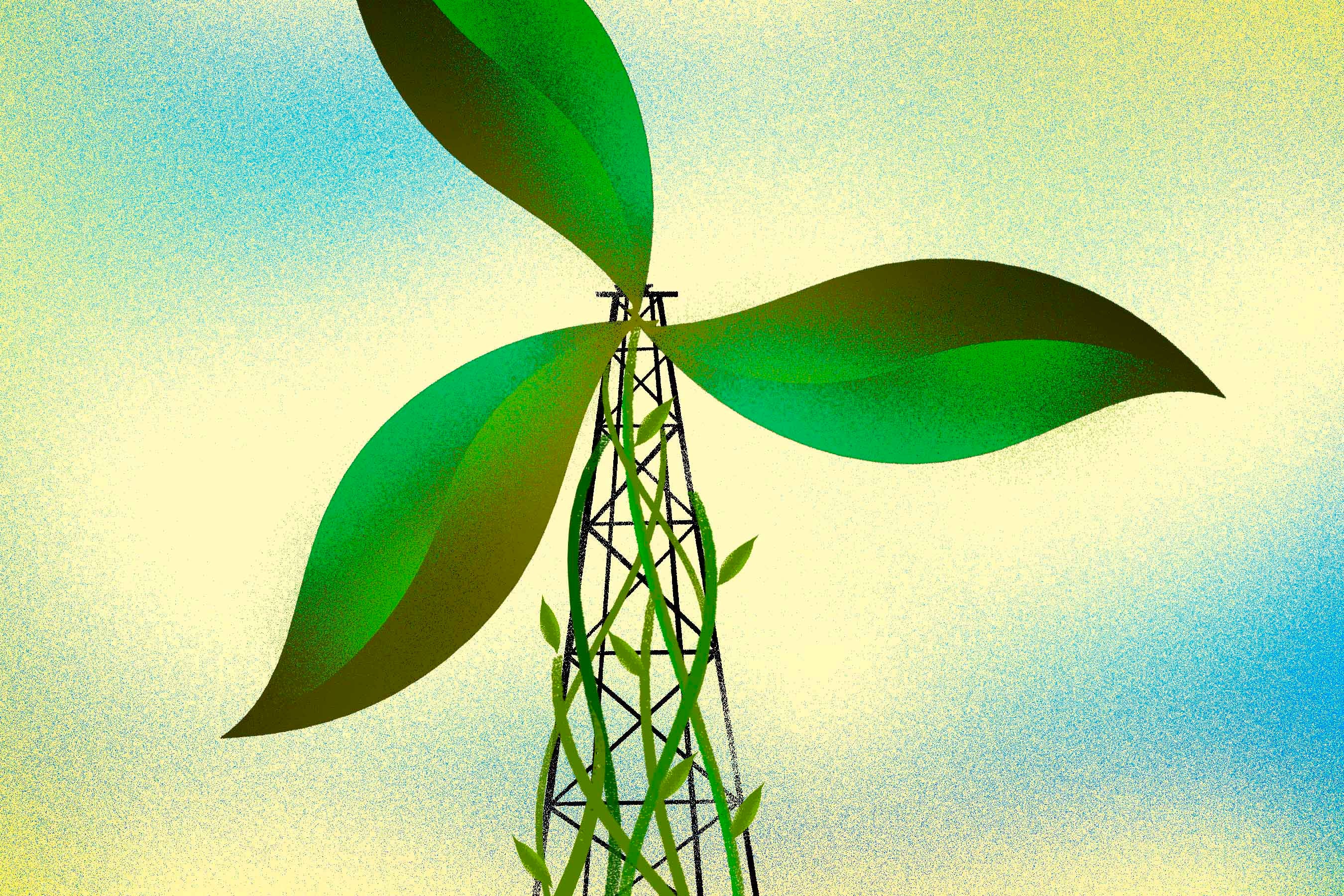Von Lena Simet, Komala Ramachandra und Sarah Saadoun
Schon als das Jahr 2020 anbrach, steckte die Welt in einer Krise. Angesichts der gewaltigen und stetig wachsenden Ungleichheit mussten Menschen, die mit geringen Ressourcen geboren wurden, damit rechnen, dass ihre grundlegenden Rechte – etwa auf Nahrung und eine menschenwürdige Unterkunft – missachtet werden. Millionen Menschen mussten Tag für Tag dafür kämpfen, ein Dach über dem Kopf zu haben und ihre Familie zu ernähren. Einer dieser Menschen war Sonía Pèrez, die in den Straßen von New York City Tamales und Reispudding verkaufte.
Die Covid-19-Pandemie machte alles noch schlimmer.
Als die Pandemie ausbrach, blieb Pèrez nichts anderes übrig, als ihre Arbeit niederzulegen. Die alleinerziehende Mutter, die mit ihrem Betrieb vier Kinder unterhielt, hatte plötzlich keine Kundschaft mehr und sie fürchtete als Diabetikerin einen schweren Verlauf von Covid-19. Wie viele andere einkommensschwache Menschen ohne nennenswerte Ersparnisse unterlag sie einem erhöhten Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren und an ihm zu sterben. Zahllose Geringverdiener wie Pèrez, insbesondere Frauen, mussten tatenlos zusehen, wie ihre Arbeitsplätze verschwanden. Für viele waren Hunger und Obdachlosigkeit die Folge.
Ihre Regierungen halfen oft nur zaghaft. Und während mehr als 9 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten, also unter schwerer Unterversorgung mit elementaren Bedarfsgütern litten, erreichte der Reichtum der Milliardäre weltweit neue Höhen und nahm im letzten Jahr um 1,5 Billionen US-Dollar zu. Mit dieser Summe ließen sich alle in extremer Armut lebenden Menschen – jeder einzelne dieser 680 Millionen Menschen – über die Grenze von 5,50 US-Dollar pro Tag heben.
Auch die wirtschaftliche Kluft zwischen den Geschlechtern wurde tiefer, da Frauen überproportional häufig ihren Arbeitsplatz verloren und über weniger soziale Absicherung verfügen. Schulschließungen und der Übergang zum digitalen Lernen zwangen viele Frauen zwischen Arbeit und Erziehung hin und her zu wechseln oder sich für eines der beiden zu entscheiden. Es fehlte an staatlicher Unterstützung und Arbeitsrichtlinien, um diesen Belastungen entgegenzuwirken.
Die wirtschaftliche Rezession durch Covid-19 betrifft die gesamte Welt. Wie sehr eine bestimmte Person darunter leidet, hängt jedoch hauptsächlich davon ab, wo sie lebt. In den Niederlanden und in Deutschland richtete der Staat seine Hilfen gezielt an Geringverdiener und ersetzte bis zu 90 Prozent der Lohnausfälle. Dies sollte es Arbeitgebern ermöglichen, ihre Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. In Indonesien bot die Regierung allen Bürgern kostenlose medizinische Behandlungen an, auch wenn sie nicht beim nationalen Krankenversicherungssystem angemeldet waren.
In vielen anderen Ländern wurden Menschen, die verzweifelt auf Hilfe angewiesen waren, jedoch sich selbst überlassen.
In den USA waren die meisten Hilfsprogramme befristet. In den ersten Monaten der Krise nahm die Armut aufgrund der Ausweitung staatlicher Sozialleistungen zwar ab, doch ein Großteil der Hilfen lief im Juli aus. So rutschten bis Oktober mehr als 8 Millionen Menschen in die Armut ab, gemessen an der Supplemental Poverty Measure, einem ergänzenden Armutsindikator der US-Statistikbehörde. Jeder zweite Haushalt hatte Probleme, alltägliche Ausgaben wie Einkäufe und Miete zu bezahlen. Millionen Menschen gaben an, keinen Zugang zum Gesundheitswesen zu haben, da sie ihre Krankenversicherung verloren hatten. Menschen ohne Dokumente oder ohne formale Beschäftigung waren von Anfang an von den Hilfsprogrammen ausgeschlossen – so auch Sonia Pèrez.
Die Ungleichheit ist nicht nur Ausdruck der weltweiten Unterschiede bei den staatlichen Sicherungssystemen und der Bereitschaft einzelner Regierungen, grundlegende wirtschaftliche Rechte zu schützen. Sie zeigt auch, welche Auswirkungen die Entscheidungen einer Regierung über die Verwendung von Covid-19-Hilfsgeldern haben können.
So erhielt Nigeria, Afrikas größte Volkswirtschaft, zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen das größte Covid-19-Nothilfepaket des Internationalen Währungsfonds (3,4 Milliarden US-Dollar) sowie weitere Hilfsgelder in Millionenhöhe. Wie genau diese Mittel verwendet wurden, ist jedoch unklar. Recherchen von Human Rights Watch ergaben, dass die überwiegende Mehrheit der bedürftigen Menschen im Stadtgebiet von Lagos keinerlei finanzielle Hilfen oder Sachleistungen erhalten haben.
Die globale Rezession wird tiefgreifende und bleibende Auswirkungen haben. Wenn Regierungen versuchen, ihre Volkswirtschaften zu retten, müssen sie dafür sorgen, dass die Unterstützung auch bei den Millionen von Menschen ankommt, bei denen die finanzielle Not besonders groß ist. Sie müssen gewährleisten, dass jeder Mensch etwas zu essen, eine Unterkunft und andere lebenswichtige Güter hat und dass die Hilfen nicht von wenigen Wohlhabenden abgegriffen werden.
Regierungen müssen mutig handeln, damit bei der Erholung der Wirtschaft für mehr Gerechtigkeit gesorgt und Menschenrechte geachtet werden. Der nächste Aufschwung sollte Ungleichheiten verringern, nicht vergrößern. Deshalb wird es entscheidend sein, auch jene Menschen in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, die von der Krise besonders hart getroffen wurden und denen die Hilfen zugute kommen sollen.
Ein Aufschwung auf dem Fundament der Menschenrechte bedeutet, für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung zu sorgen, Arbeitnehmerrechte zu schützen, Rückschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter zu verhindern und sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum und grundlegenden Versorgungsleistungen wie Wasser und sanitären Einrichtungen haben.
Es bedeutet, in öffentliche Leistungen und soziale Sicherungssysteme zu investieren und fortschrittliche Ansätze in der Finanz- und Steuerpolitik anzustoßen und zu verfolgen. Es bedeutet, Programme zu finanzieren, die es jedem Menschen erlauben, sein Recht auf einen menschenwürdigen Lebensstandard zu verwirklichen.
Vor allem aber gilt es, in vernachlässigte Bevölkerungsgruppen zu investieren und schädliche fiskalpolitische Sparmaßnahmen zu vermeiden, etwa Einschnitte bei der sozialen Sicherheit. Die Erfahrungen aus Spanien und Argentinien haben auf schmerzhafte Weise gezeigt, dass solche kontraproduktiven Einschnitte den Menschenrechten schaden, die soziale Ungleichheit vergrößern und Menschen finanziell verwundbarer machen.
In den kommenden Jahren werden viele Regierungen mit Haushaltslücken und einer gestiegenen Schuldenlast zu kämpfen haben. Angesichts dessen sollten internationale wirtschaftspolitische Akteure wie die Weltbank und der IMF sie darin unterstützen, angemessene soziale Sicherungssysteme aufzubauen und fortschrittliche Instrumente zur Erhöhung ihrer Einnahmen zu etablieren, statt sich schädliche Sparmaßnahmen zu verordnen. Portugals Widerstand gegen einen solchen Sparkurs im Jahr 2015 hat gezeigt, dass sich eine Volkswirtschaft auch dann auf Kurs bringen lässt, wenn die soziale Absicherung verbessert, der Mindestlohn erhöht und die Renten gestärkt werden.
Bei den Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft sollte die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit Priorität haben. Nur so lässt sich verhindern, dass weitere Hunderte Millionen Menschen in extreme Armut abrutschen. Viele dieser Menschen begegnen schon heute verschiedenen Formen intersektioneller Diskriminierung, die sie in ihren wirtschaftlichen Rechten einschränken. Deshalb müssen Regierungen die wirtschaftlichen Rechte als fundamentale Rechtsnormen anerkennen und jedem Menschen garantieren.
Hätte man diese Probleme schon vor Ausbruch der Pandemie bekämpft, wären ihre Auswirkungen auf die Rechte von Menschen wie Sonía Pèrez und unzähligen anderen womöglich weniger gravierend ausgefallen. Es ist Zeit, dass Regierungen die Fehler der Vergangenheit korrigieren und sich der Vision einer gerechteren, die Menschenrechte achtenden Welt verschreiben.