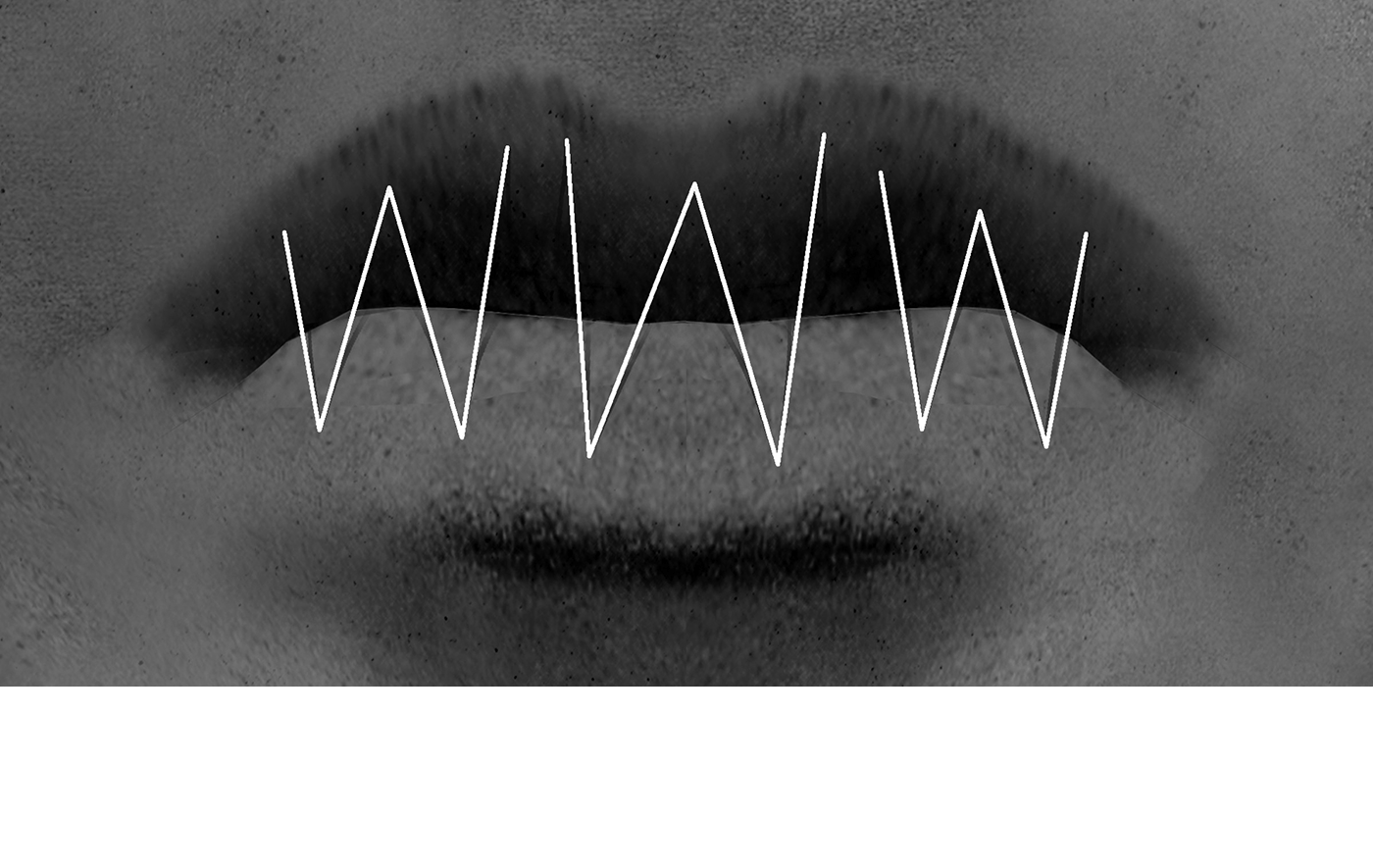Die Menschenrechte existieren, um Menschen vor Missbrauch und Vernachlässigung durch Regierungen zu schützen. Sie setzen dem Handeln von Staaten Grenzen und verpflichten sie zu bestimmten Verhaltensweisen. Dieser Zusammenhang wird heute von einer neuen Generation von Populisten auf den Kopf gestellt. Sie behaupten, für das „das Volk“ zu sprechen, und behandeln die Menschenrechte wie ein Hindernis für ihre Auffassung des Mehrheitswillens – eine nutzlose Hürde beim Schutz der Nation vor vermeintlichen Gefahren und Übeln. Statt die Menschenrechte als Schutz für alle zu akzeptieren, privilegieren die Populisten die angeblichen Interessen der Mehrheit. Sie reden den Menschen ein, dass sie selbst ihre Rechte nie gegen eine übereifrige, angeblich in ihrem Namen handelnde Regierung verteidigen werden müssen.
Der Reiz der Populisten wächst mit dem öffentlichen Unmut über den Status Quo. Viele Menschen in der westlichen Welt fühlen sich durch den technischen Fortschritt, die Globalisierung der Wirtschaft und die zunehmende soziale Ungleichheit abgehängt. Entsetzliche Terrorakte schüren Sorgen und Ängste. Manche Menschen erfüllt es mit Unbehagen, dass Gesellschaften ethnisch und religiös vielfältiger geworden sind. Das Gefühl, dass Regierungen und Eliten die Belange der Allgemeinheit ignorieren, macht sich breit.
In diesem Klima der Unzufriedenheit können Politiker glänzen und sogar in Machtpositionen aufsteigen, indem sie ein verzerrtes Bild der Menschenrechte zeichnen, wonach diese ausschließlich Terrorverdächtige oder Asylsuchende schützen – auf Kosten der Sicherheit, des Wohlstands und der kulturellen Vorlieben der vermeintlichen Mehrheit. Die Populisten machen Flüchtlinge, Einwanderer und Minderheiten zum Sündenbock. Dabei bleibt die Wahrheit häufig auf der Strecke, während sich Nativismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Islamfeindlichkeit breit machen.
Diese gefährlichen Trends bedrohen die Errungenschaften der modernen Menschenrechtsbewegung. Diese konzentrierte sich in ihren Anfangsjahren vor allem auf die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und die Unterdrückung im Zuge des Kalten Kriegs. Nachdem man erlebt hatte, zu welchem Unrecht Regierungen imstande sind, wurde eine Reihe von Menschenrechtsabkommen geschlossen, die künftige Verbrechen verhindern oder zumindest eindämmen sollten. Man war der Auffassung, der Schutz der darin festgelegten Rechte sei unverzichtbar, um jedem Individuum ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die zunehmende Achtung dieser Rechte sollte die Grundlage für freiere, sicherere und erfolgreichere Gesellschaften bilden.
Heute gelten die Menschenrechte einer wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr als Schutzmechanismus, sondern vielmehr als Hindernis für die Bemühungen der Regierung zu ihrem Schutz. Sowohl in den USA als auch in Europa steht die Einwanderung an der Spitze der Liste gefühlter Bedrohungen. Bei diesem Thema überschneiden sich die Sorgen um die kulturelle Identität, die wirtschaftlichen Chancen und den Terrorismus. Ermutigt von den Populisten scheint ein wachsender Teil der Öffentlichkeit zu glauben, das Recht schütze nur die „Anderen“, nicht sie selbst, und sei deshalb entbehrlich. Wenn die Mehrheit die Rechte von Flüchtlingen, Migranten und Minderheiten einschränken will, so argumentieren die Populisten, dann sollte sie dies auch dürfen. Die Tatsache, dass internationale Verträge und Institutionen dem im Wege stehen, sorgt – in einer Welt, in der Nativismus oft über Globalismus gestellt wird – für eine noch stärkere Abneigung gegen das Recht.
Vielleicht liegt es in der Natur des Menschen, dass es ihm schwer fällt, sich mit Menschen, die anders sind, zu identifizieren, und damit leichter, Verletzungen ihrer Rechte hinzunehmen. Viele Menschen trösten sich mit der gefährlichen Annahme, Rechtsnormen ließen sich selektiv vollstrecken, es sei also möglich, dass die Rechte anderer verletzt werden, während die eigenen geschützt bleiben.
Doch Rechte lassen schon dem Wesen nach keine Anwendung „à la carte“ zu. Man mag seine Nachbarn nicht mögen, doch gibt man ihre Rechte preis, riskiert man früher oder später auch seine eigenen Rechte zu verlieren. Denn letzten Endes basieren Rechtsnormen auf der gegenseitigen Pflicht, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Wenn die Rechte einiger weniger verletzt werden, wackeln auch die Rechte der vermeintlichen Mehrheit, in deren Namen die Verletzungen stattfinden.
Es ist zu unserem eigenen Schaden, wenn wir die Demagogen vergangener Zeiten vergessen – Faschisten, Kommunisten und andere, die behaupteten, über ein privilegiertes Verständnis der Interessen der Mehrheit zu verfügen, und dem Individuum letzten Endes jeden Raum nahmen. Wenn Populisten das Recht wie ein Hemmnis für ihre Vision des Mehrheitswillens behandeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich gegen all jene wenden, die ihrer Agenda widersprechen. Noch gefährlicher wird es, wenn Populisten die Unabhängigkeit der Justiz angreifen, weil diese die Rechtsstaatlichkeit verteidigt und Rechte durchsetzt, die den Handlungsspielraum der Regierung einschränken.
Das Streben nach einer ungehemmten Herrschaft der Mehrheit und die Angriffe auf die Kontrollmechanismen, welche die Macht von Regierungen einschränken, stellen heute die vielleicht größte Bedrohung für die Zukunft der Demokratie in der westlichen Welt dar.
Wachsende Bedrohung, schwache Reaktion
Statt dieser Populismuswelle die Stirn zu bieten, setzen sich viele westliche Politiker, die offenbar das Vertrauen in die Menschenrechte verloren haben, nur halbherzig für deren Schutz ein. Wenige Regierungschefs waren gewillt, die Menschenrechte entschlossen zu verteidigen – mit den bemerkenswerten Ausnahmen, zumindest zeitweise, von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und US-Präsident Barack Obama.
Manche Politiker scheinen den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, der Sturm des Populismus werde sich bald legen. Andere scheinen, wenn sie nicht versuchen, aus den populistischen Gefühlen Kapital zu schlagen, zumindest dem Wunschdenken zu erliegen, eine Nachahmung der Populisten könne deren Aufstieg zügeln. Die britische Premierministerin Theresa May empörte sich, dass „aktivistische linke Menschenrechtsanwälte“ es wagten, das britische Militär wegen seiner Folter im Irak anzugehen. Frankreichs Präsident François Hollande bediente sich im Repertoire des Front National, als er versuchte, den Entzug der französischen Staatsbürgerschaft bei in Frankreich geborenen Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft ins Zentrum seiner Antiterrorstrategie zu stellen – eine Initiative, die er später zurückzog und, wie er sagte, bedauerte. Die niederländische Regierung befürwortete Einschränkungen für die Gesichtsverschleierung bei muslimischen Frauen. Viele europäische Regierungschefs unterstützen die Forderung des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, Europas Grenzen zu schließen und Flüchtlinge damit im Stich zu lassen. Dieses Kopieren populistischer Positionen bestärkt und legitimiert all jene, die die Menschenrechte angreifen.
Ein ähnlicher Trend ist auch außerhalb der westlichen Welt zu beobachten. Tatsächlich scheint der Aufstieg der Populisten im Westen auch Staatschefs außerhalb der westlichen Welt ermutigt zu haben, ihre Missachtung der Menschenrechte zu intensivieren. So verteidigt der Kreml Wladimir Putins autoritäre Herrschaft mit dem Verweis auf die zunehmend getrübte Menschenrechtsbilanz des Westens. Ebenso wie Putin lässt Xi Jinping in China Kritiker so hart verfolgen wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. In der Türkei nutzte Präsident Recep Tayyip Erdoğan einen Putschversuch als Gelegenheit, oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi intensivierte die nach seiner Machtübernahme eingeleiteten repressiven Maßnahmen. Auf den Philippinen forderte Präsident Rodrigo Duterte unverhohlen die massenhafte Hinrichtung mutmaßlicher Drogenhändler und -konsumenten sowie der Menschenrechtler, die für ihre Rechte eintreten. In Indien versuchte Premierminister Narendra Modi, kritische Bürgerrechtsgruppen zu verbieten, während er gleichzeitig die Augen vor Repressalien und Hassverbrechen gegen religiöse und ethnische Minderheiten durch hindu-nationalistische Gruppen verschloss.
Syriens Präsident Baschir al-Assad handelte in der Gewissheit, dass er von Seiten des Westens abgesehen von gelegentlichen Protesten nichts zu befürchten hat, und trat mit Unterstützung Russlands, des Irans und der libanesischen Hisbollah das Kriegsvölkerrecht mit Füßen, indem er skrupellos Zivilisten in den oppositionell kontrollierten Landesteilen angriff, insbesondere in Ost-Aleppo. Mehrere afrikanische Staatschefs, die sich von einer möglichen Strafverfolgung durch die nationale oder internationale Justiz bedroht fühlten, übten harsche Kritik am Internationalen Strafgerichtshof und kündigten in drei Fällen an, sich von dem Tribunal zurückzuziehen.
Um diesen Trends entgegenzuwirken, ist eine umfassende Rückbesinnung auf die Menschenrechte nötig. Der Aufstieg der Populisten sollte die Politiker der etablierten Parteien zwar zu einer kritischen Selbstanalyse veranlassen; er sollte jedoch nicht dazu führen, dass Staatsbeamte oder die Öffentlichkeit mit fundamentalen Prinzipien brechen. Regierungen, denen die Achtung der Menschenrechte ein echtes Anliegen ist, dienen ihrer Bevölkerung am besten, wenn sie sich gegen die Korruption, Selbstverherrlichung und Willkür rüsten, welche eine autokratische Herrschaft häufig mit sich bringt. Denn nur wenn der Staat fest auf dem Boden der Menschenrechte steht, ist er in der Lage, die Anliegen seiner Bürger zu hören, ihre Sorgen ernst zu nehmen und ihre Probleme zu bewältigen. Und zu guter Letzt lässt sich eine Regierung, die die Menschenrechte achtet, auch leichter auswechseln, wenn die Bevölkerung mit ihrer Amtsführung unzufrieden ist.
Sollten sich der Ruf nach einem starken Führer und die Stimmen der Intoleranz durchsetzen, droht der Welt eine dunkle Ära. Man sollte niemals die Neigung der Demagogen unterschätzen, die Rechte der „Anderen“ zunächst in unserem Namen zu opfern, nur um dann – wenn ihre wahre Priorität, der Machterhalt, gefährdet ist – auch unsere Rechte über Bord zu werfen.
Trumps gefährliche Rhetorik
Der Erfolg von Donald Trumps Kampagne im US-Präsidentschaftswahlkampf war ein Musterbeispiel für diese Politik der Intoleranz. Teils offen, teils auf Umwegen oder verschlüsselt machte sich Trump zum Sprachrohr der Unzufriedenheit vieler Amerikaner angesichts einer stagnierenden Wirtschaft und einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft. Er tat dies in einer Weise, welche die Grundprinzipien von Würde und Gleichheit verletzte. Trump bediente Klischees über Migranten, verunglimpfte Flüchtlinge, attackierte einen Bundesrichter wegen seiner mexikanischen Abstammung, verhöhnte einen Journalisten mit Behinderung, leugnete mehrere Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe und kündigte an, die Wahlfreiheit von Frauen über Geburtenkontrolle abzuschaffen. Noch schwerer wog, dass ein Großteil seiner Rhetorik in der Praxis so gut wie bedeutungslos war. So kreiste ein großer Teil seines Wahlkampfs um Angriffe auf Handelsabkommen und Globalisierung, aber auch um Schuldzuweisungen an Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere, die den Amerikanern angeblich die Jobs wegnehmen. Doch die von Trump angedrohten Massenabschiebungen von Migranten, von denen viele über gefestigte Bindungen in den USA verfügen und produktiv zur Wirtschaft beigetragen haben, werden mit Sicherheit keine der seit langem verlorenen Industriearbeitsplätze in den USA zurückbringen. Momentan entwickelt sich der Arbeitsmarkt in den USA positiv. Insoweit er für gewisse Bevölkerungsgruppen tatsächlich stagniert, ist dies wohl kaum den undokumentierten Migranten anzulasten, deren Anzahl in den letzten Jahren praktisch konstant war und die oft bereit sind, Tätigkeiten zu verrichten, zu denen die meisten US-Amerikaner nicht bereit wären.
Ebenso sinnlos, wenn nicht gar kontraproduktiv, war Trumps Plan zur Terrorbekämpfung, der genau jene muslimischen Bevölkerungsgruppen dämonisierte, deren Kooperation unverzichtbar ist, um künftige Terrorplots aufzudecken. Trump stellte Flüchtlinge als Sicherheitsrisiko dar, obwohl sie weitaus gründlicheren Prüfungen unterworfen werden als die erheblich größere Anzahl von Personen, die geschäftlich, zu Studiuenzwecken oder als Touristen in die USA einreisen. Er signalisierte zudem keine Bereitschaft, ausufernde Maßnahmen wie die Massenüberwachung einzuschränken. Letztere stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre dar und hat sich nicht als wirksamer erwiesen als eine gezielte, richterlich kontrollierte Überwachung.
Trump spielte sogar mit der Idee, Foltermethoden wie waterboarding wiedereinzuführen. Offenbar hat er vergessen, welchen Boom Präsident George W. Bush mit seinen „erweiterten Verhörmethoden“ den Rekrutierern der Terroristen bescherte. Trumps späte Einsicht in die Ineffizienz von Folter, die er nach den Wahlen im Anschluss an ein Gespräch mit dem General bekundete, den er anschließend an die Spitze des Verteidigungsministeriums stellte, ist nur ein schwacher Trost. Denn er erklärte im gleichen Atemzug seine Bereitschaft, Folter dennoch anzuordnen, „wenn das amerikanische Volk das will“. In Trumps Augen kann niemand diesen Wunsch besser auslegen als er selbst, auch wenn er sich dafür über Gesetze und Verträge hinwegsetzt, die das Zufügen solcher Gräuel und Schmerzen ungeachtet der Umstände verbieten.
Die Populismuswelle in Europa
In Europa versuchten Populisten in ähnlicher Weise, die Migration, sowohl die Zuwanderung von außen als auch die Binnenmigration, für den wirtschaftlichen Stillstand verantwortlich zu machen. Doch alle, die gehofft hatten, mit ihrer Stimme für den Brexit – dem wohl markantesten Beispiel für diesen Trend – der Migration Einhalt zu bieten, laufen stattdessen Gefahr, Großbritanniens Wirtschaft nachhaltig zu schaden.
Auf dem gesamten europäischen Kontinent beschworen Funktionäre und Politiker eine weit zurückliegende und teilweise frei erfundene Vergangenheit der vermeintlichen ethnischen Reinheit, obwohl es in den meisten Ländern etablierte Einwanderergruppen gibt, die gekommen sind, um zu bleiben, und deren Integration als produktive Mitglieder der Gesellschaft durch diese Feindseligkeit „von oben“ untergraben wird. In der flüchtlingsfeindlichen Politik einiger Staatschefs wie Ungarns Viktor Orbán liegt eine tragische Ironie: Während Europa einst Flüchtlinge aus Ungarn willkommen hieß, die vor der Unterdrückung der Sowjets flohen, lässt Orbáns Regierung heute keine Gelegenheit ungenutzt, um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, das Leben schwer zu machen.
Keine Regierung ist verpflichtet, jeden ins Land zu lassen, der an ihrer Tür klopft. Doch das internationale Recht schränkt ein, was Regierungen zur Kontrolle der Migration tun dürfen: Menschen, die Zuflucht suchen, müssen ein faires Verfahren erhalten. Wenn ihr Gesuch für begründet befunden wird, muss ihnen Asyl gewährt werden. Menschen, die seit vielen Jahren in einem Land leben oder dort familiäre Bindungen eingegangen sind, der Weg zu einem dauerhaften Rechtsstatus eröffnet werden. Hiervon sind nur klar eingegrenzte Ausnahmen zulässig. Eine Inhaftierung darf nicht willkürlich erfolgen. Abschiebungen müssen einem rechtsstaatlichen Verfahren unterworfen sein.
Unter diesen Vorbehalten dürfen Regierungen Wirtschaftsflüchtlinge ausweisen und zurück in ihre Heimat schicken.
Die Rechte von Einwanderern, die gesetzestreu in einem Land leben, müssen jedoch – entgegen der Forderungen der Populisten – in vollem Umfang gewahrt werden. Niemand sollte beim Zugang zu Wohnraum, Bildung und Arbeit diskriminiert werden. Jeder Mensch hat ungeachtet seines Aufenthaltsstatus ein Anrecht auf Schutz durch die Polizei und eine faire Behandlung durch die Justiz.
Um den Einwanderern zu helfen, sich zu integrieren und in vollen Umfang an der Gesellschaft teil zu haben, müssen Regierungen Investitionen vornehmen. Insbesondere Vertreter des Staates tragen die Pflicht, den Hass und die Intoleranz der Populisten zurückzuweisen und für ein unabhängige und unparteiische Justiz einzutreten, der die Aufrechterhaltung des Rechts obliegt. So lässt sich am besten gewährleisten, dass die demokratischen Traditionen, die sich historisch als der beste Weg zum Wohlstand erwiesen haben, auch im Zuge der Diversifizierung vieler Staaten erhalten bleiben.
Besonders in Europa rechtfertigen Politiker ihre Feindseligkeit gegenüber Migranten, insbesondere Muslimen, mit der Behauptung, diese wollten die in vielen Herkunftsländern herrschende Unterdrückung von Frauen, Schwulen und Lesben importieren. Die einzig richtige Antwort auf diese Formen der Repression ist jedoch, sie abzulehnen – schließlich sind sie der Grund, warum viele der Migranten geflohen sind – und dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft die Rechte aller anderen achten. Eine falsche Antwort hingegen ist es, einem Teil der Gesellschaft – im heutigen Umfeld typischerweise Muslimen – Rechte zu verweigern, um dadurch vermeintlich die Rechte anderer zu schützen. Eine selektive Anwendung untergräbt die Universalität der Menschenrechte und damit ihren Kerngehalt.
Wachsender Autoritarismus in der Türkei und in Ägypten
Erdoğans zunehmend diktatorische Amtsführung in der Türkei zeigt, wie gefährlich ein Führer ist, der im Namen der Mehrheit die Menschenrechte mit Füßen tritt. Seit Jahren zeigt Erdoğan immer weniger Toleranz für Kritiker, die seine Pläne in Frage stellen, sei es bei der Bebauung des Gezi-Parks im Zentrum von Istanbul oder bei der Verfassungsänderung zur Ausweitung der Exekutivbefugnisse des Präsidenten.
Im vergangenen Jahr nutzten Erdoğan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung einen Putschversuch mit Hunderten Opfern als Gelegenheit, um nicht nur gegen die Drahtzieher des Staatsstreichs vorzugehen, die angeblich mit dem im Exil lebenden Geistlichen Fethullah Gülen in Verbindung stehen, sondern auch gegen Zehntausende von Gülens vermeintlichen Anhänger. Die Ausrufung des Ausnahmezustands wurde auch zum Anlass genommen, andere mutmaßliche Kritiker ins Visier zu nehmen und einen Großteil der unabhängigen Medien und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen zu zerschlagen. Angeblich um gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK vorzugehen, ließ die Regierung Funktionäre und Abgeordnete der wichtigsten Kurdenpartei im Parlament inhaftieren und von ihr gestellte Bürgermeister entlassen.
Angesichts der kollektiven Erleichterung, die viele Türken nach dem Scheitern des Putschs spürten, genoss Erdoğans Regierung nach dem Staatsstreich breiten Rückhalt über alle Parteigrenzen hinweg. Nachdem die Repression als Präzedenzfall etabliert und die Unabhängigkeit der Gerichte und anderer Gesetzesorgane beschnitten waren, konnte Erdoğan seine immer weiter reichenden Maßnahmen ohne jeden Widerstand durchsetzen. Wer eine rasche und entschlossene Antwort westlicher Staatschefs erwartet hatte, wurde enttäuscht. Dem standen vielfach andere Interessen wie die Begrenzung des Flüchtlingsstroms nach Europa oder die Bekämpfung des selbst erklärten Islamischen Staats im Weg.
Ägypten durchlief unter der Regierung von Präsident al-Sisi eine ähnliche Entwicklung. Unzufrieden mit der kurzen Herrschaft der Muslimbruderschaft unter Präsident Mohammed Mursi begrüßten viele Ägypter den von al-Sisi angeführten Putsch im Jahr 2013. Doch al-Sisi ging zu einem Regierungsstil über, der sogar die Repression des langjährigen Diktators Hosni Mubarak übertraf, welcher im Zuge des Arabischen Frühlings entmachtet worden war. So befehligte al-Sisi im August 2013 die Tötung von mindestens 817 Demonstranten aus den Reihen der Muslimbrüder an einem einzigen Tag. Dies war eines der größten Massaker an Demonstranten in der Neuzeit. Viele Ägypter rechneten damit, dass nur Islamisten verfolgt würden, doch al-Sisi beschnitt auch die politischen Freiräume anderer Gruppen radikal: Menschenrechtsorganisationen, unabhängige Medien und oppositionelle Parteien wurden verboten. Zehntausende Menschen wurden, oft unter Folter und praktisch ohne Gerichtsverfahren, inhaftiert.
Der oberflächliche Reiz des „starken Mannes“
Die anschwellende Welle des Populismus im Namen vermeintlicher Mehrheiten wird überlagert von einer neuen Vernarrtheit in die Idee des „starken Führers“, die besonders im Präsidentschaftswahlkampf in den USA offenkundig wurde. Wenn die erklärten Interessen der Mehrheit das einzige sind, was zählt, warum sollte man dann nicht einen Autokraten unterstützen, der keine Skrupel zeigt, seine Vision des Mehrheitswillens durchzusetzen, so eigennützig sie auch sei, und jeden zu unterwerfen, der sie ablehnt?
Das von den Populisten geschürte Feuer des Moments vernebelt jedoch die längerfristigen Gefahren, welche eine „starke Führung“ für die Gesellschaft birgt. So präsidiert Wladimir Putin über eine zunehmende Schwäche der russischen Wirtschaft, die unter extremer Korruption und dem Versäumnis leidet, sich zu Zeiten hoher Ölpreise nicht diversifiziert zu haben. Dies machte sie anfällig für den anschließenden Abschwung. Aus Angst, der öffentliche Unmut könnte erneut um sich greifen und wie Anfang 2011 in Moskau und mehreren anderen Städten auf die Straße getragen werden, versuchte Putin mit drakonischen Einschränkungen der Versammlungs- und Meinungsfreiheit, beispiellosen Sanktionen für Kritik im Internet und der Drangsalierung von Bürgerrechtsgruppen gegenzusteuern.
Der Kreml stützte Putins Autokratie und ließ seine sinkenden Zustimmungswerte wieder in die Höhe schnellen, indem er den Nationalismus der Bevölkerung durch den russischen Einmarsch auf der Krim mobilisierte, obwohl dieser EU-Sanktionen nach sich zog und die Wirtschaftsflaute verschärfte. In Syrien sorgte Putin mit seiner Unterstützung von Assads Blutvergießen an Zivilisten und der Entsendung russischer Bomber dafür, dass die Aufhebung der Sanktionen noch unwahrscheinlicher wird. Bis heute versuchen die geschickten Propagandisten des Kreml die zunehmende wirtschaftliche Not damit zu rechtfertigen, dass man die Bemühungen des Westens zur Schwächung Russlands abwehren müsse. Da sich die Wirtschaftslage jedoch zusehends verschlechtert, wird es immer schwieriger für die russischen Apologeten, der Öffentlichkeit diese Botschaft zu verkaufen.
Chinas Präsident Xi hat einen ähnlich repressiven Pfad eingeschlagen. China erfreute sich eines bemerkenswerten Wirtschaftswachstums, da frühere Staatschefs das Land auf dem Gebiet der Wirtschaft von der Willkür der Kommunistischen Partei befreiten, welche etwa für den desaströsen „Großen Sprung“ und die Kulturrevolution verantwortlich gewesen waren. Die wirtschaftliche Liberalisierung wurde jedoch nicht von politischen Reformen begleitet. Alle Reformbestrebungen blieben nach der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 als Totgeburt zurück. Die darauffolgenden Regierungen trafen wirtschaftliche Entscheidungen hauptsächlich, um das Ziel der Partei sicherzustellen, das Wachstum um jeden Preis aufrechtzuerhalten und so die Unzufriedenheit der Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Die Korruption erlebte eine Blüte, während die soziale Ungleichheit wuchs und die Umwelt Schaden nahm.
Ebenfalls aus Sorge, der Unmut in der Bevölkerung könne im Zuge der Wirtschaftsflaute zunehmen, leitete Xi das schärfste Vorgehen gegen Kritiker seit der Tiananmen-Ära ein und reduzierte die Rechenschaftspflicht der Regierung sogar noch unter das Niveau jener Zeit. Trotz seiner zahlreichen selbst verliehenen Titel wirkt dieser „starke Führer“ zunehmend furchtsam, während er den Forderungen der chinesischen Bevölkerung nach sauberer Luft, sicherem Essen, einer gerechten Justiz und einem rechenschaftspflichtigen Staat nicht gerecht werden kann.
Ähnliche Tendenzen kennzeichneten auch die Herrschaft anderer Autokraten. In Venezuela hat sich die von Hugo Chávez initiierte und heute von seinem Nachfolger Nicolás Maduro fortgeführte Bolivarische Revolution als wirtschaftliches Desaster erwiesen, insbesondere für die sozial schwachen Bevölkerungsgruppen, denen sie angeblich dienen sollte. Die Folge waren Hyperinflation, schwere Lebensmittel- und Medikamentenengpässe sowie ein Land, das trotz der größten bekannten Ölreserven der Welt in die Armut abrutschte. Die Regierung ließ Polizei- und Militärrazzien in Einwanderer- und Armengemeinden durchführen, die weitreichende Missbrauchsvorwürfe nach sich zogen, etwa wegen außergerichtlicher Hinrichtungen, willkürlicher Deportationen, Räumungen und dem Abriss von Wohnhäusern.
Unterdessen setzte Präsident Maduro, der auch die Justiz kontrolliert, die Geheimdienste ein, um willkürlich Oppositionspolitiker und Regierungskritiker zu verhaften und anzuklagen. Er hintertrieb die Gesetzgebung der Oppositionsmehrheit in der Nationalversammlung und behinderte ein Amtsenthebungsreferendum über seine Verbündeten bei der Wahlbehörde.
Historisch ist die Liste der Autokraten, die Erfolge für sich selbst, aber nicht für ihr Volk erzielen, lang. Selbst in Ländern wie Äthiopien und Ruanda, die als Musterbeispiele für den Erfolg autoritärer Regierungen in der Entwicklungspolitik gelten, stößt man bei näherem Hinsehen auf von der Regierung verursachtes Leid. So zwang die äthiopische Regierung Bauern und Hirten im ländlichen Raum, sich in Dörfern mit schlechter Infrastruktur niederzulassen, um Platz für landwirtschaftliche Großprojekte zu machen. Die ruandische Regierung ließ Straßenverkäufer und Bettler zusammentreiben und gewaltsam in schäbige Haftzentren sperren, um für „saubere“ Straßen zu sorgen. In Zentralasien regieren zahlreiche „starke Führer“, deren Staaten dank ihrer fortgesetzten Herrschaft nach Sowjet-Manier auf der Stelle treten. Selbst in den relativ dynamischen Staaten Südostasiens wird der wirtschaftliche Fortschritt heute von der lähmenden Herrschaft der thailändischen Militärjunta und der korrupten Regierung von Malaysias Premierminister Najib Razak bedroht.
Angriffe auf zivilgesellschaftliche Vereinigungen und den Internationalen Strafgerichtshof
In Afrika gingen einige der beunruhigendsten Angriffe auf die Menschenrechte auf das Konto von Autokraten, die – statt ihre Macht friedlich abzugeben – mit Gewalt oder Gesetzgebung gegen Kritiker vorgingen. Eine erschreckende Anzahl afrikanischer Staatschefs ließ Beschränkungen der Amtszeit einfach verlängern oder ganz abschaffen – ein Vorgehen, das auch als verfassungsmäßiger Putsch bezeichnet wird. Andere antworteten mit Gewalt auf Widerstand und öffentliche Proteste wegen gefälschter oder unfairer Wahlen. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo in Äquatorialguinea, Yoweri Museveni in Uganda und Robert Mugabe in Zimbabwe, die alle seit mehr als 30 Jahren im Amt sind, veranlassten Verfassungsänderungen, um weiter im Amt bleiben zu können.
In den vergangenen Jahren gelangten Präsidenten, die weitere Amtszeiten anstrebten, teilweise durch die Unterdrückung jeglicher Opposition zum Ziel, wie in Ruanda, teilweise durch die gewaltsame Unterdrückung von Demonstrationen wie in Burundi und der Demokratischen Republik Kongo. Viele dieser Regime bedienten sich ähnlicher Instrumente, um zivilgesellschaftliche Vereinigungen und unabhängige Medien zu drangsalieren, den Zugang zu sozialen Medien bzw. dem Internet zu verhindern und politische Gegner in die Knie zu zwingen. Die Angriffe auf zivilgesellschaftliche Vereinigungen richteten sich in erster Linie gegen deren Finanzierungsquellen – eine Taktik bei der Äthiopien führend war. Regierungen, die sich selbst um Finanzhilfen, Handel und Investitionen aus dem Ausland bemühten, gingen plötzlich gegen Gruppen vor, die ausländische Gelder einwarben.
Die Weigerung von Autokraten, ihre Macht abzugeben, geht oft mit der Angst einher, wegen Verbrechen, die sie während ihrer Amtszeit verübt haben, strafrechtlich verfolgt zu werden. Der burundische Präsident Pierre Nkurunziza war der erste, der ankündigte, sich vom Internationalen Strafgerichtshof zurückzuziehen, weil er durch die von ihm gelenkte gewaltsame Unterdrückung zu einem Musterkandidaten für die Justiz geworden war. Gambias Präsident und brutaler Diktator Yahya Jammeh schloss sich dieser Haltung wenig später an. Er wurde jedoch kurze Zeit darauf abgewählt, und sein gewählter Nachfolger Adama Barrow kündigte an, Jammehs Entscheidung zum Austritt aus dem Tribunal rückgängig zu machen. In Südafrika, das im Hinblick auf Justiz und Menschenrechte lange eine Vorreiterrolle in Afrika eingenommen hatte, leitete Präsident Jacob Zuma das Verfahren zum Austritt aus dem IStGH ein. Zuma wurde von Korruptionsvorwürfen verfolgt und wegen seiner Entscheidung kritisiert, sich über eine richterliche Anordnung hinweggesetzt und dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir erlaubt zu haben, das Land zu verlassen - statt sich wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem IStGH zu verantworten. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, dessen Anklage durch den IStGH aufgehoben wurde, nachdem Zeugen unter Druck gesetzt und Ermittler von der Regierung behindert worden waren, stachelte die Afrikanische Union zu Attacken gegen den IStGH an.
Dass diese wenigen afrikanischen Staatschefs nicht für alle Afrikaner sprechen, bewiesen zivilgesellschaftliche Vereinigungen auf dem ganzen Kontinent, die ihre Unterstützung für den IStGH bekräftigten. Dabei erhielten sie Unterstützung von Staaten wie Nigeria, Tansania, dem Senegal und Ghana. Sie durchschauten die vorgeschobene Behauptung, der IStGH – der derzeit von einer afrikanischen Chefanklägerin geleitet wird, die für ein Ende der Straflosigkeit kämpft, wegen der so viele Afrikaner Gräueltaten ohne irgendwelche Kompensation erlitten haben – sei in irgendeiner Form afrikafeindlich.
Der IStGH, der seine Ermittlungen im Jahr 2015 ausschließlich auf Opfer aus Afrika konzentriert hatte, muss das Problem bewältigen, dass mächtige Staaten wie die USA, China und Russland dem Tribunal nicht beigetreten sind. Bis November 2016 hatte das Gericht in mehreren wichtigen Fällen außerhalb Afrikas, in denen bereits vorbereitende Untersuchungen durchgeführt wurden, noch keine offiziellen Ermittlungen eingeleitet, etwa bei der straflosen Folter durch US-Beamte in Afghanistan oder bei Israels Politik der illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland.
Wenn es den Gegnern des Strafgerichtshofs wirklich um eine gleichberechtigte Justiz geht, sollten sie dafür eintreten, dass diese Ermittlungen zu Ende geführt werden. Sie sollten zudem Russland und China drängen, ihr Veto im UN-Sicherheitsrat nicht länger dafür einzusetzen, um eine Übertragung der Rechtsprechung über Gräueltaten in Syrien an den IStGH zu blockieren. Hinter ihrem Schweigen zu diesem umfassenderen Streben nach Gerechtigkeit ist ihr eigentliches Hauptanliegen verborgen: Die Hoffnung auf Strafverfolgung im eigenen Land zu untergraben. Die Tatsache, dass mehrere afrikanische Staaten den IStGH durch ein afrikanisches Tribunal ersetzen wollen, von dessen Rechtsprechung amtierende Präsidenten und andere hochrangige Beamte ausgenommen sind, spricht Bände.
Die Angriffe auf den IStGH beschränkten sich nicht nur auf Afrika, sie verfolgten jedoch stets das Ziel der Straflosigkeit. Nachdem die Chefanklägerin des IStGH Vorermittlungen wegen der mutmaßlichen Verbrechen während des russisch-georgischen Konflikts im Jahr 2008 eingeleitet und auch die Situation in der Ukraine geprüft hatte, zog Russland seine Unterschrift unter das IStGH-Statut zurück – ein symbolischer Schritt ohne praktische Bedeutung, da Moskau das Statut lediglich unterzeichnet, jedoch nie ratifiziert hatte. Der philippinische Präsident Duterte bezeichnete den IStGH als „nutzlos“, nachdem die Chefanklägerin gewarnt hatte, Dutertes Unterstützung für standrechtliche Exekutionen könnte unter die Rechtsprechung des IStGH fallen.
Der IStGH, der laut Mandat über schwerste Verbrechen in aller Welt urteilen soll, wenn nationale Gerichte versagen, wird auch in Zukunft mit mächtigen politischen Interessenvertretern in Konflikt geraten, die sich gegen eine strafrechtliche Verantwortlichkeit sträuben. Um dennoch erfolgreich zu sein, benötigt er eine ebenbürtige politische und praktische Unterstützung durch seine Befürworter.
Angriffe auf Zivilisten in Syrien
Der Konflikt in Syrien stellt die womöglich schwerste Bedrohung für die Normen des Völkerrechts dar. Es gibt keine grundlegendere Regel im Kriegsvölkerrecht als das Verbot von Angriffen auf Zivilisten. Doch Assads militärische Strategie bestand bislang darin, gezielt und wahllos auf Zivilisten zu feuern, die in den Gebieten leben, welche von der bewaffneten Opposition kontrolliert werden. Auch zivile Gebäude wie Krankenhäuser wurden gezielt angegriffen.
Durch verheerende Luftangriffe, unter anderem mit Fassbomben, Streubomben, Artilleriesperrfeuer und gelegentlich sogar mit chemischen Waffen hat Assad weite Teile syrischer Städte verwüstet. Ziel dieses Vorgehens ist es, die Gebiete zu entvölkern und den Oppositionsstreitkräften so ihre Operationen zu erschweren. Es wird ergänzt durch tödliche Belagerungen, welche die Zivilbevölkerung aushungern und so zur Kapitulation zwingen sollen.
Ungeachtet dieser offenkundigen Kriegsverbrechen wird Assad seit September 2015 von russischen Streitkräften unterstützt. Dies verstärkte Assads Schlagkraft zwar erheblich, änderte jedoch nichts an seiner Strategie. Tatsächlich besteht eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen der Strategie Assads und dem Vorgehen des Kremls bei der Zerstörung der tschetschenischen Hauptstadt Grosny in den Jahren 1999 und 2000, die den bewaffneten Aufstand dort brechen sollte.
Die Kriegsverbrechen gegen Zivilisten werden verübt, ohne dass es nennenswerte internationale Bemühungen gibt, ihre Drahtzieher zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sind der Hauptgrund dafür, dass so viele Syrer auf der Flucht sind. Die Hälfte der syrischen Bevölkerung wurde so vertrieben. Etwa 4,8 Millionen Menschen suchten in Nachbarländern Zuflucht, von ihnen flohen 1 Million weiter nach Europa. Doch wenn es um Syrien geht, konzentriert sich der Westen weiter vor allem auf den IS. Dieser ist zwar für entsetzliche Gräueltaten verantwortlich und stellt auch weit über die Grenzen seiner Rückzugsgebiete in Syrien und im Irak hinaus eine Bedrohung dar, doch seine zivilen Opferzahlen in Syrien werden von denen Assads weit übertroffen. Örtliche Quellen schätzen, dass Assads Streitkräfte und seine Verbündeten für etwa 90 Prozent der zivilen Todesopfer in Syrien verantwortlich sind.
Da Assads politisches Überleben heute von Russlands militärischer Unterstützung abhängt, verfügt Putin über ein enormes Potential, um Einfluss auf Assads Handeln zu nehmen. Dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Kreml diesen Einfluss geltend macht, um dem Blutvergießen an Zivilisten Einhalt zu bieten. Stattdessen beteiligten sich russische Bomber sogar, wie im tragischen Fall Aleppos, regelmäßig an den Angriffen.
Ungeachtet dessen zeigte besonders die US-Regierung eine enttäuschende Zurückhaltung, wenn es darum ging, Russland zu einer Einflussnahme zu drängen. Sie konzentrierte sich vielmehr auf Russlands Rolle als Partner bei den Friedensgesprächen, die sich endlos hinzogen, ohne Ergebnisse zu liefern. Unterdessen ließen die fortdauernden Angriffe auf Zivilisten es immer unwahrscheinlicher werden, dass die syrische Opposition zu einer Einigung mit der Regierung kommt.
Seiner Wahlkampfrhetorik nach zu urteilen ist der designierte US-Präsident Trump entschlossen, den Fokus der USA noch stärker auf den IS zu verengen. Zu diesem Zweck brachte Trump sogar eine Zusammenarbeit mit Putin und Assad ins Gespräch. Dabei ignoriert er die Tatsache, dass Putin und Assad zum einen nur wenig ihrer Energie gegen den IS aufwenden, sowie die Rolle ihrer Gräueltaten als Triebfeder für die Rekrutierungsbemühungen des IS. Selbst wenn der IS letzten Endes militärisch besiegt wird, drohen diese Gräueltaten neue Extremistengruppen entstehen zu lassen, genau so wie ähnliche Verbrechen zur Entstehung des IS aus den Überresten von Al Qaida im Irak beigetragen hatten.
Warum ein neues Bekenntnis zu den Menschenrechten nötig ist
Angesichts dieses weltweiten Angriffs auf die Menschenrechte brauchen wir eine entschiedene Beteuerung und Verteidigung der grundlegenden Werte, die hinter diesen Rechten stehen.
Dabei sind viele wichtige Rollen zu vergeben. Zivilgesellschaftliche Organisationen, vor allem solche, die für den Schutz von Rechten kämpfen, müssen bürgerliche Freiräume dort verteidigen, wo sie bedroht sind. Sie müssen Bündnisse schmieden, die über alle Bevölkerungsgruppen hinweg reichen und deutlich machen, dass der Schutz der Menschenrechte im Interesse aller liegt. Und sie müssen die Spaltung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden überwinden, um gemeinsam gegen die Autokraten vorzugehen, die offenkundig voneinander lernen.
Die Medien sollten ein Schlaglicht auf die gefährlichen Entwicklungen werfen, die sich momentan abspielen. Dabei sollten sie ihre Berichterstattung über das Tagesgeschehen mäßigen und vielmehr dessen langfristige Auswirkungen analysieren. Sie sollten besondere Anstrengungen unternehmen, um die Propaganda und „Fake News“ bestimmter Parteien bloßzustellen und zu entkräften.
Regierungen, die vorgeben, den Menschenrechten verpflichtet zu sein, müssen sich häufiger für den Schutz grundlegender Prinzipien einsetzen. Dies schließt auch die Demokratien in Lateinamerika, Afrika und Asien ein, die heute regelmäßig für positive UN-Initiativen anderer Staaten abstimmen, selbst aber nur selten eine Führungsrolle einnehmen, sei es bei der UN oder in direkten Beziehungen zu anderen Staaten.
Letztlich trägt auch die Öffentlichkeit eine Verantwortung. Die Demagogen feilschen mit Einzelfallbetrachtungen. Sie gewinnen öffentliche Unterstützung, indem sie für reale Probleme falsche Erklärungen und einfache Lösungen zurechtbiegen. Das beste Gegenmittel ist eine Öffentlichkeit, die nach einer Politik verlangt, welche auf der Wahrheit und den Werten basiert, auf denen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie fußen. Populisten blühen auf, wenn keine Opposition vorhanden ist. Eine starke Antwort der Öffentlichkeit, die alle verfügbaren Instrumente nutzt – zivilgesellschaftliche Vereine, politische Parteien sowie traditionelle und soziale Medien – ist der beste Schutz für die Werte, die so viele Menschen auch im Angesicht von Problemen noch hochhalten.
Lügen werden nicht wahr, nur weil sie von einer Armee von Internet-Trollen oder einer Legion von Anhängern vertreten werden. Dennoch sind Resonanzräume für Unwahrheiten unvermeidlich. Aber auch Fakten sind nach wie vor mächtig. Gerade deshalb unternehmen Autokraten so große Anstrengungen, um all jenen den Mund zu verbieten, die über unangenehme Wahrheiten berichten, besonders wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht.
Werte sind fragil. Die Werte der Menschenrechte beruhen vor allem auf der Fähigkeit zu Mitgefühl und auf der Erkenntnis, wie wichtig es ist, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Deshalb sind sie verletzlich gegenüber dem Ruf der Demagogen nach Abgrenzung. Die Kultur der Achtung für die Menschenrechte bedarf steter Pflege, damit vorübergehende Ängste nicht die Weisheit zersetzen, auf der die Demokratie beruht.